A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.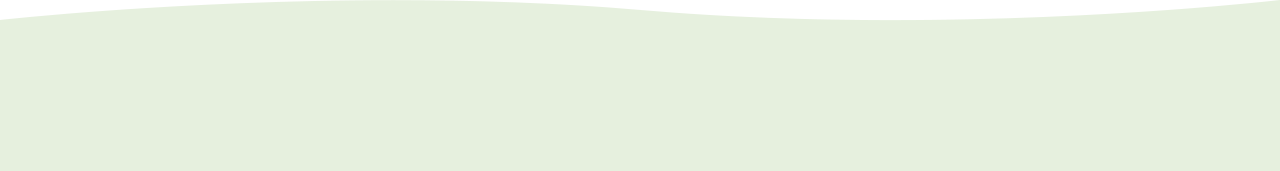
Seltene Krankheiten
Weltweit sind rund 7000 bis 8000 seltene Erkrankungen bekannt. Sie betreffen jeweils eine relativ kleine Zahl von Menschen und bringen aufgrund ihrer Seltenheit besondere Probleme in Bezug auf Informationen, Diagnose, Behandlungsmöglichkeiten und Unterstützung der Betroffenen mit sich.

Bild: Fotolia / pressmaster
Was eine seltene Krankheit ist, wird in verschiedenen Ländern und Staaten verschieden beurteilt: In Australien gilt eine Krankheit als selten, wenn eine Person pro 10000 Einwohnern betroffen ist, in Japan liegt die Quote bei vier Personen auf 10000 Einwohner, in den USA rechnet man siebeneinhalb Betroffene auf 10000 Menschen.
In der EU und der Schweiz gilt eine Erkrankung dann als selten, wenn höchstens fünf von 10 000 Personen an ihr leiden.
Ein zusätzliches Kriterium für die Einordnung als seltene Krankheit ist «gemäss internationaler Übereinkunft», dass sie «lebensbedrohend ist oder eine chronische Invalidität nach sich zieht».
Autor: Ingrid Zehnder, 01/17
- Waisenkinder der Medizin
- Millionen sind betroffen
- Wie sehen die Krankheitsbilder aus?
- Wenige «Seltene» sind bekannter ...
- ... beispielsweise Mukoviszidose
- ... beispielsweise ALS
- ... beispielweise Progerie
- ... beispielsweise Niemann-Pick Typ C
- Leiden, mitleiden, kämpfen, hoffen
- Die Mühlen der Ämter mahlen langsam
- Forschung
- Preise an der Schmerzgrenze
- Nützliche Adressen
Seltene Krankheiten werden international auch als rare (selten) und orphan (verwaist) diseases bezeichnet. Sie sind aber nicht nur «Waisen» im Hinblick auf medizinische, medikamentöse, psychologische, soziale und finanzielle Versorgung/Betreuung, sondern auch in Bezug auf das öffentliche Interesse. Erst 1997 wurde vom französischen Gesundheitsministerium «Orphanet» ins Leben gerufen, ein Projekt, das eine Datenbank rund um seltene Krankheiten und deren Behandlungsmöglichkeiten beinhaltet.Seither haben sich diesem Projekt 40 Partnerländer angeschlossen, so auch die Schweiz,Deutschland und Österreich.
Vermittelt werden zahlreiche Informationen sowohl für Forschende und Fachleute in Praxen und Spitälern als auch für Patienten bzw. deren Familienangehörige. Seit zehn (in D) bzw. sieben (in CH) Jahren wird jeweils am letzten Tag im Februar (2017 : 28. 2.) der «Internationale Tag der seltenen Krankheiten – Rare Disease Day» begangen, um Aufmerksamkeit für die Probleme und Bedürfnisse der Betroffenen zu schaffen. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf der Forschung und dem Appell an Wissenschaft und Politik, sich die Bedeutung der Forschung bewusst zu machen und sie besser zu fördern. An und um diesen Tag herum finden in vielen Ländern zahlreiche Aktionen, Infoveranstaltungen, Fach- Symposien, Treffen von Selbsthilfevereinen und bunte Programme statt.
So selten die einzelne Krankheit sein mag, so viele Menschen leiden insgesamt. Die grosse Zahl der seltenen Erkrankungen führt dazu, dass sechs bis acht Prozent der Weltbevölkerung von einer von ihnen betroffen sind. In Europa spricht man von 30 Millionen Patienten, in Nordamerika von 27 Millionen. In Deutschland geht man von vier Millionen Betroffenen aus, in der Schweiz sprechen Schätzungen von etwa 580 000 Kranken, darunter 350 000 Kinder und Jugendliche. Eine genaue Zahl von seltenen Krankheiten anzugeben, ist insofern schwierig, als teilweise unterschiedliche Bezeichnungen bzw. Synonyme vorliegen und in der Fachliteratur laufend neue «Fälle» beschrieben werden.
Die Vielfalt an Krankheitsbildern ist gross und umfasst u.a. Krebserkrankungen, Störungen des Stoffwechsels, des Blut-, Nerven- und Immunsystems, Erkrankungen bestimmter Organe und Gewebe, Infektionen sowie Defekte während der embryonalen Entwicklung. Mehr als 80 Prozent der seltenen Krankheiten sind genetisch bedingt. Die ersten Symptome können schon kurz nach der Geburt oder in früher Kindheit auftreten. Andere Erkrankungen manifestieren sich erst im Erwachsenenalter. Bei sehr vielen seltenen Leiden sind die Ursachen bis heute unbekannt und entsprechend fehlen wirksame Therapien.
Einige der seltenen Krankheiten sind – mindestens dem Namen nach – bekannter als andere; Tausende kennt man überhaupt nicht.
Zu den bekanntesten gehört die Mukoviszidose oder, wie die Krankheit international genannt wird, die Cystische Fibrose (CF). Dabei handelt es sich um eine vererbte Stoffwechselkrankheit, die in der Schweiz eines von knapp 2700 Neugeborenen betrifft. Die Multisystemerkrankung kann die Funktion der Atemorgane, des Verdauungstrakts, des Skeletts sowie der Fortpflanzungsorgane beeinträchtigen. Über 100 verschiedene Genmutationen führen zur Erkrankung.
Interessant ist, dass eine bestimmte Mutation europaweit nur in der Schweiz vorkommt. Seit Januar 2011 wird im Rahmen des Neugeborenen-Screenings in der Schweiz auch auf Cystische Fibrose getestet; Deutschland hat erst im Frühjahr 2016 eine solche Untersuchung eingeführt. Eine frühe Diagnose kann die Lebensqualität der Betroffenen durch die Behandlung und Beratung in spezialisierten CF-Zentren erheblich steigern. Durch den medizinischen Fortschritt der letzten 20 Jahre wurden neue Behandlungsmöglichkeiten für die unheilbare Erkrankung etabliert; dadurch steigerte sich die mittlere Lebenserwartung auf über 40 Jahre. Seit fünf Jahren steht in der EU und der Schweiz ein Medikament zur Verfügung, das bei etwa vier Prozent der Patienten wirksam ist. 2015 wurde ein Kombipräparat zugelassen, das bei rund 60 Prozent der Betroffenen die Anfälle von Atemnot verringern und eine Verschlechterung der Lungenfunktion hinauszögern könnte.
Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erreichte 2014 einen höheren öffentlichen Bekanntheitsgrad durch die weltweite «Ice Bucket Challenge», bei der sich Menschen mit eiskaltem Wasser übergossen und Geld für die ALS-Forschung spendeten. Von 50000 Personen erkrankt pro Jahr ein Erwachsener neu an der unheilbaren degenerativen Erkrankung des motorischen Nervensystems. Gegen den fortschreitenden Untergang der für die Muskelbewegungen zuständigen Nervenzellen gibt es kein ursächlich wirkendes Medikament. Als Dauertherapie kann der neuroprotektive Wirkstoff Riluzol gegeben werden, der den Verlauf der Erkrankung verzögert und die Überlebenszeit im Durchschnitt um drei Monate verlängert.
Sicher haben Sie auch schon Bilder gesehen von kleinen Kindern mit kahlen Köpfen, riesengrossen Augen und faltiger, dünner Haut. Von der Krankheit Progerie, der frühzeitigen Vergreisung, sind weltweit etwa 50 Babys und Kinder betroffen. Die Erkrankten, die meist geistig hellwach sind, leiden unter vielfachen Beschwerden, werden selten älter als 14 Jahre und sterben häufig an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall. Im Mai 2016 fanden amerikanische Wissenschaftler heraus, worin der genetische Defekt bei Progerie besteht, doch die Zeit bis zur Entwicklung eines Mittels, das die Krankheit aufhalten könnte, ist nicht absehbar.
Diese rezessiv vererbte Stoffwechselerkrankung ist in der Schweiz relativ bekannt geworden, weil der Vater eines erkrankten Jungen Journalist ist und die Geschichte seines Sohnes publizierte und andererseits in einer Familie gleich drei Kinder erkrankt sind. Die Krankheit kann Kinder, Jugendliche und Erwachsene treffen und ist mit einer Häufigkeit von 1 : 120 000 tatsächlich äusserst selten. Bei Erwachsenen verläuft die Krankheit langsamer und ist häufig begleitet von psychischen Erkrankungen (Psychosen, Depressionen etc.).
Im Stoffwechsel benötigte Lipide/Fette wie Cholesterin stauen sich in den Zellen und zerstören sie. In der oft vergrösserten Leber und Milz sowie im Gehirn entstehen mit den Jahren Schäden, die zum Verlust der kognitiven Fähigkeiten («Alzheimer der Kinder»), zu Schwerstbehinderung und letztendlich zum Tod führen.
Die Entwicklung in der frühen Kindheit ist zunächst unauffällig; später leiden die Kleinen unter motorischer Schwäche, Schlaf-, Sprach- und Schluckstörungen, Stimmungsschwankungen und Krampfanfällen. Physiotherapie, Ergo- und Logopädie können den Erhalt bestimmter Fähigkeiten unterstützen und Arzneien einige Symptome lindern. Zusätzlich steht ein seit 2010 in Deutschland und der Schweiz zugelassenes, nicht gerade nebenwirkungsarmes Medikament (Wirkstoff Miglustat) zur Verfügung, das den Betroffenen Hoffnung gibt. Es verringert die Produktion des Cholesterins und somit die übermässige Speicherung in den Zellen. Damit ist zwar keine Heilung verbunden, aber eine Stabilisierung des Zustands und eine Verlangsamung des Fortschreitens der heimtückischen Krankheit.
Wie viele Menschen mit einer seltenen Krankheit nie eine Diagnose erhalten, weiss man nicht. Man weiss aber, dass für 4 000 bis 5 000 dieser Leiden derzeit keine Behandlung zur Verfügung steht. Einen chronisch Kranken in der Familie zu haben, erfordert viel Zeit, Kraft, Anstrengung, Mitgefühl, Mut und Liebe. Ist ein Kind unheilbar krank, wird die Herausforderung riesengross – so gross, dass manche Familien daran zerbrechen.
Bei vielen Erkrankungen kann eine frühe Diagnose die Lebensqualität entscheidend verbessern. Tatsache ist aber, dass es oft Jahre dauert, bis eine genaue Diagnose vorliegt. So merkwürdig sich das anhört: Nach der Odyssee von Arzt zu Arzt, von Spezialist zu Spezialist stellt sich zunächst Erleichterung ein. Doch dann beginnt die Suche: nach relevanten Informationen, nach der bestmöglichen Behandlung, geeigneten Hilfsmitteln, kompetenten Fachkräften, Unterstützung bei der Betreuung, nach einem passenden Kindergarten, einer Schule oder einer angemessenen Ausbildung. Menschen mit seltenen Krankheiten (und ihre Angehörigen) müssen mit vielen Einschränkungen, Belastungen und Benachteiligungen leben.
Erschwerend kommen nicht selten nanzielle Sorgen und komplizierte Verhandlungen mit Behörden, Versicherungen und Invaliden- und Krankenkassen dazu. Die Allianz seltener Krankheiten, ProRaris, formuliert: «Leider ist der Kenntnisstand zu seltenen Krankheiten heute noch in allen Berufssparten begrenzt, auch bei Fachkräften im Gesundheitswesen oder bei Sozialversicherungen.»
Das Schweizerische Bundesamt für Gesundheit verabschiedete 2014 das «Nationale Konzept Seltene Krankheiten». Der dazugehörige Umsetzungsplan wurde im Mai 2015 veröffentlicht. Damit soll in der ganzen Schweiz die Zusammenarbeit zwischen behandelnden Ärzten, Vertrauensärzten und Versicherungen hinsichtlich Kostenübernahme und genetischer Analysen standardisiert werden. Das Konzept schlägt 19 konkrete Massnahmen vor. Eine der wichtigsten ist die Schaffung von Referenzzentren, in denen Forschung, Wissen und Behandlung seltener Krankheitsgruppen gebündelt werden. Bis Ende 2017 sollen die Referenzzentren gebildet werden, Anzahl und Standorte feststehen.
Die Hoffnung vieler Betroffener richtet sich vornehmlich auf neue Medikamente für die seltenen Krankheiten, die allgemein als «Orphan Drugs» bezeichnet werden. Für eine optimale Forschungsarbeit auf den Gebieten der Grundlagenforschung (Genforschung) und der anwendungsorientierten Forschung (klinische Studien, Therapie) ist eine weltweite Zusammenarbeit der Experten sowie die Einbeziehung einer möglichst hohen Zahl von Patienten nötig.
Obwohl die Pharmafirmen immer wieder versi- chern, wie langwierig, teuer und unberechenbar die Suche nach neuen Wirkstoffen sei, interessiert sich die Branche zunehmend für die seltenen Krankheiten. Einerseits kann die Erforschung dieser Krankheiten auch für das Verständnis weiter verbreiteter Leiden Erkenntnisse bringen. Andererseits bringen Orphan Drugs ordentlich Geld in die Kassen. Denn: Um die Forschung anzukurbeln, haben viele Staaten die Zulassung von neuen Medikamenten erleichtert und kostspielige Gebühren erlassen oder reduziert. Der Orphan Drug-Status geht mit einer zehnjährigen Marktexklusivität einher; sie kann auf zwölf Jahre erhöht werden, wenn das Medikament auch für Kinder zugelassen wird.
Wenige Orphan Drugs können chronisch Kranke dauerhaft heilen oder den Betroffenen einige lebenswerte Jahre schenken, bei anderen ist die gewonnene Überlebenszeit auf wenige Wochen be- schränkt oder der Nutzen eher zweifelhaft. Nicht alle Orphan Drugs sind sehr teuer, aber doch viele und manche sogar exorbitant teuer – und an den immensen Kosten für die Solidarsysteme entzünden sich zunehmend Diskussionen.
Das bislang teuerste Medikament wurde nur einmal eingesetzt: bei einer besonders schweren Form der äusserst seltenen Stoffwechselkrankheit Lipoproteinlipase-Defizienz. Für die benötigten 40 Injektionen der Gentherapie fielen Kosten von über einer Million Euro an.
Mukoviszidose-Patienten (Kinder ab zwei Jahren) mit bestimmten, relativ seltenen Genmutationen können seit 2012 (in D) bzw. 2015 (in CH) mit dem Wirkstoff Ivacaftor ursächlich behandelt werden. Die lebenslange Therapie kostet pro Jahr ca. 300000 Franken. Der Hersteller verteidigt die hohen Kosten mit der geringen Patientenzahl. Inzwischen entwickelte die gleiche Firma für eine grössere Gruppe von Patienten (ab 12 Jahren) mit Cystischer Fibrose ein weiteres Medikament, das Ivacaftor mit dem Wirkstoff Lumacaftor kombiniert; die jährlichen Kosten für die Dauertherapie belaufen sich auf 150000 bis 190000 CHF. Ein Segen für die Betroffenen, stehen diese Mittel auch stellvertretend für massgeschneiderte Arzneistoffe, welche die Folgen von Gendefekten mildern können. Die Verbesserung der Arzneimittelversorgung bei seltenen Krankheiten liegt allen am Herzen. Sicher ist: Die ökonomischen Nebenwirkungen für das Gesundheitssystem sind gewaltig.
Orphanet ist ein umfangreiches und informatives «Portal für seltene Krankheiten und Orphan Drugs» mit dem Ziel, Diagnose, Versorgung und Behandlung zu verbessern. Mit Zugang zu Infos in allen Partnerländern, u.a. Deutschland und Österreich. www.orpha.net
Für die Schweiz (dt., frz.): www.orphanet.ch Mit «Neuigkeiten, Veranstaltungen und Dokumen- ten von nationaler Bedeutung».
Eurordis – European Rare Diseases Organisation
ist eine nicht-staatliche Allianz von 724 Patienten- organisationen aus 64 Ländern und mehr als 4 000 seltenen Krankheiten (in sieben Sprachen). www.eurordis.org / Mail: eurordis@eurordis.org
ProRaris, Allianz seltener Krankheiten – Schweiz bietet zahlreiche Informationen und Vernetzung von Betroffenen/Angehörigen mit passenden Ansprechpartnern. Die Stiftung betreibt und fördert Forschung auf dem Gebiet der Genetik. (dt., frz.) 3007 Bern, Sulgeneckstrasse 35
Tel. 031 331 17 33
www.proraris.ch / Mail: contact@proraris.ch
Der gemeinnützige Förderverein für Kinder mit seltenen Krankheiten setzt sich für die betroffenen Kinder und ihre Familien ein. Er organisiert finanzielle Direkthilfe, verankert das Thema in der Öffentlichkeit und schafft Plattformen, um betrof- fene Familien miteinander zu vernetzen.
CH-8610 Uster, Ackerstrasse 43
Tel. 044 752 52 52
www.kmsk.ch /Mail: info@kmsk.ch
Die ACHSE, Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen e.V., ist ein Netzwerk von und für Menschen mit (chronischen) seltenen Erkrankungen und ihre Angehörigen. Zahlreiche Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen haben sich in ihr zusammengeschlossen. Zusätzlich bietet eine an der Charité Berlin angesiedelte ACHSE-Lotsin auch ratsuchenden Medizinern Informationen und Recherchehilfe zu seltenen Erkrankungen an.
c/o DRK Kliniken Berlin | Mitte
13359 Berlin, Drontheimer Strasse 39,
Tel. 030/ 3300708-0 (Mo bis Fr, 9 bis 13Uhr) www.achse-online.de / Mail: info@achse-online.de


