A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.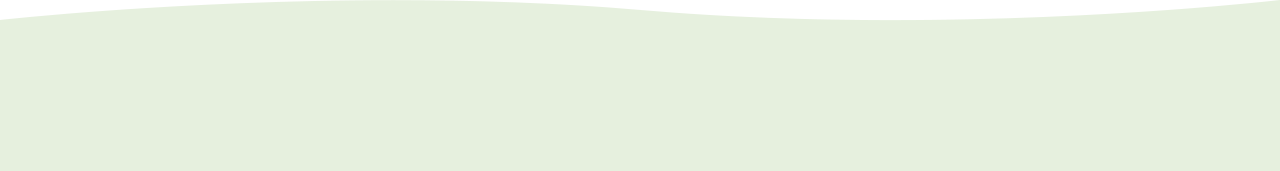
Botox: Anwendungen in der Medizin
Dass Botox Krähenfässe, Lach- und Zornesfalten glättet und Stirnrunzeln verhindert, weiss mittlerweile jedes Kind. Weniger bekannt ist, welche Rolle das Nervengift in der Medizin spielt.
Angefangen hat alles vor etwa 50 Jahren. Damals wurde das seit 1820 bekannte Botulinumtoxin erstmals medizinisch genutzt, und zwar bei Augenproblemen wie Schielen, krankhaftem Augenzucken und Lidkrämpfen. Zum Objekt der Begierde für faltenlose Gesichter wurde Botox dann in den 1990er-Jahren, und nach der Zulassung als kosmetische Anwendung im Jahr 2002 kam der Boom so richtig in Fahrt. Seither hat das Gift eine steile Karriere gemacht und lässt bei den wenigen Herstellern die Kassen klingeln: Weltweit werden etwa fünf Milliarden Euro pro Jahr umgesetzt. Wie Schweizer Medien im Juni dieses Jahres berichteten, steigt nun auch der Nestlé-Konzern in das lukrative Geschäft mit dem Schönheits-Gift ein.
Autorin: Ingrid Zehnder 10/14
- Was ist Botox?
- Gebremste Mimik, entspannte Muskeln
- Vom Wurstgift zum Lifestyleprodukt
- Schweiz an erster Stelle
- Botox bei übermässigem Schwitzen
- Botox bei chronischer Migräne
- Botox bei fokaler Dystonie
- Botox gegen Schiefhals
- Behandlung weiterer Dystonien
- Botox gegen Lidkrampf
- Botox bei Schielen
- Botox bei Spastik
- Noch mehr mögliche Behandlungsfelder
- Hunderttausende von Mäusen sterben
Botox ist der Handelsname der bisher marktbeherrschenden US-Firma Allergan für Botulinumtoxin und mit der Zeit zum Oberbegriff für alle anderen Präparate geworden. Produziert werden die giftigen Proteine vom Bakterium Clostridium botulinum. Das Bakterium kommt natürlicherweise weltweit vor – speziell im Erdboden, aber auch in See- und Meeres-Sedimenten. Sein Toxin ist eines der stärksten bekannten Gifte; weniger als ein Millionstel Gramm vom Typ A reichen, um einen 70 Kilo schweren Menschen zu töten. Botulinumtoxin war früher nicht selten in verdorbenen Wurstwaren und -konserven zu finden und verursachte tödliche Lebensmittelvergiftungen. So wurde der Name des Giftes von lateinisch botulus (Wurst) hergeleitet. Innerhalb der Botulinumtoxine unterscheidet man neun verschiedene Subtypen, die mit Buchstaben bezeichnet sind. Für den Menschen giftig sind davon fünf (A, B, E, F und H), andere sind für Pferde, Rinder, Geflügel und Wasservögel gefährlich. Medizinisch genutzt werden die Typen A und B.
Das Bakteriengift verhindert, dass Nervenfasern den Botenstoff Acetylcholin freisetzen. Dadurch erhalten die Muskeln keinen Befehl mehr, sich zusammenzuziehen. Je nach Dosierung bedeutet das: Die betreffenden Muskeln werden entspannt und schlaff bis gelähmt. Kosmetisch und medizinisch wird das weisse Pulver vor der Anwendung extrem verdünnt und mit haarfeinen Nadeln gespritzt. Bis die Wirkung eintritt, dauert es einige Tage, und sie hält an, bis der Körper die Nervenenden «repariert» hat, was in zwei bis sechs Monaten geschehen kann. Dann muss erneut gespritzt werden. In der Schweiz und Deutschland darf Botox – im Gegensatz zur aufpolsternden Hyaluronsäure – nur von Ärzten angewendet werden. Prinzipiell von jedem Arzt. Doch die Handhabung des gefährlichen Nervengiftes erfordert besondere Voraussetzungen, sodass Patienten empfohlen wird, sich nur an ausgewiesene Praxen/Kliniken zu wenden.
Dass Prominente und viele, die es sich leisten können, zugegebenermassen oder heimlich regelmässig Botox-Injektionen machen lassen, ist bekannt. In Grossstädten ist «Botox to go» oder «Walk in» üblich geworden, und die schnelle Behandlung in der Mittagspause bezahlen auch Bankangestellte, Sekretärinnen oder Abteilungsleiter zwei- bis drei- mal im Jahr.
Erschreckend ist allerdings, dass immer mehr Konsumenten gar keine mimischen Falten haben und nach dem Motto «vorbeugen ist besser als heilen» handeln.
In den USA stieg der Anteil der Botox-Behandlungen bei den 20- bis 29-Jährigen von 2011 bis 2012 um acht Prozent, und auch in Europa sind in dermatologischen Sprechstunden Zwanzigjährige keine Seltenheit.
Durch die Presse gingen seltsame Auswüchse des Geschäfts mit der Schönheit. Da war der spanische Wanderarzt, der im Souterrain eines Kölner Coiffeurs den versammelten Damen die faltenverursa- chenden Gesichtsmuskeln lähmte und das Plissee an den Lippen wegzauberte; da versuchte eine Münchner Ärztin im Internet mit günstigen Botox-Gutscheinen zu werben; da sollte die Pleite einer Beauty-Klinik mit Botox-Flatrates zu Schleuderpreisen abgewendet werden; da berichtet eine Mutter im US-Fernsehen stolz, sie spritze ihrer achtjährigen Tochter vor deren Auftritten bei Schönheitswettbewerben Botox – und sie sei da nicht die Einzige. Horror!
Immerhin kann es bei nicht sachgemässer Anwendung zu Nebenwirkungen kommen. Hängende Augenlider, Asymmetrie der Gesichtshälften, schiefes Lächeln oder schockgefrorene Mienen sind Folgen von Kunstfehlern, die allerdings vergehen, sobald das Gift abgebaut ist.
Der umfassende Gesundheits-Newsletter von A.Vogel erscheint 1 x pro Monat und enthält Informationen, Tipps, Wettbewerbe und vieles mehr – rund um alle Gesundheitsthemen.
2012, zum 10-jährigen Jubiläum der Botox-Zulassung für kosmetische Anwendungen durch die US Food and Drug Administration, schrieb die Neue Zürcher Zeitung: «In Europa gilt die Schweiz als Botox-Hochburg. Es gibt rund 1100 Kliniken und Praxen, die Botox anwenden. Die meisten finden sich in den Grossräumen Zürich und Genf. Sie haben 2011 rund 200000 Behandlungen durchgeführt – ein Umsatzwachstum von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit Botox werden in der Schweiz über 100 Millionen Franken umgesetzt.»
Hyperhidrose der Achseln ist in der Schweiz die einzige von Swissmedic zugelassene Indikation. Menschen, deren Schweissdrüsen ständig ohne Not auf Hochtouren laufen, sind nicht zu beneiden. Eine von mehreren Behandlungsmöglichkeiten ist die Therapie mit Botulinumtoxin. Dabei werden keine Muskeln gelähmt, sondern die Übertragung von Nervenreizen auf die Schweissdrüsen blockiert. Meist muss sich der Patient etwa 50 Spritzen in jede Achselhöhle setzen lassen. Nach sechs bis neun Monaten muss die schmerzhafte Prozedur wiederholt werden. Eine Behandlung von Schweisshänden und -füssen mit Botox bezahlen die Krankenkassen nicht. Sie ist zudem so quälend, dass meist eine Vollnarkose nötig ist.
Um eine chronische Migräne handelt es sich, wenn die Schmerzen jeden zweiten Tag oder öfter auftreten. Injektionen an bestimmten Punkten der Augen, der Nase, der Schläfen, des Nackens oder der Schultern können die Symptome lindern. In der Regel muss die Behandlung alle zwölf Wochen wiederholt werden. In Deutschland erstatten die Krankenkassen die Kosten, in der Schweiz hängt es von einer Entscheidung im Einzelfall ab. Nicht nachgewiesen ist der Nutzen einer Botox-Therapie bei episodischer Migräne und Spannungskopfschmerzen.
Darunter versteht man eine lokale Störung in der feinmotorischen Bewegung, bei der es zu unwillkürlichen und unkontrollierbaren Muskelkontraktionen kommt. Die Erkrankung tritt bei Menschen auf, deren Tätigkeit ein extremes Mass an Übung und Genauigkeit fordert, so bei Musikern, Chirurgen, Uhrmachern oder Feinmechanikern. Es kann z.B. passieren, dass ein Gitarrist eine Seite nicht zupfen oder ein Pianist mit einem Finger keine Taste anschlagen kann, während die Finger oder Hände bei alltäglichen Tätigkeiten bestens funktionieren. Botox-Injektionen hemmen die überaktiven Muskelkontraktionen und müssen auch hier regelmässig wiederholt werden. Es sind jedoch auch Fälle bekannt, in denen die Wiederholung zu einer Bildung von Antikörpern führte, die eine weitere Behandlung wirkungslos macht.
Die zervikale Dystonie, auch als Schiefhals bezeichnet, ist die häufigste Form der fokalen Dystonie. Die Krankheit äussert sich durch abnorme Kopfstellungen und Kopfbewegungen, die durch einen überaktiven Muskelzug des Kopfes in die falsche Richtung bzw. überaktive Hals- und Nackenmuskeln bedingt sind. Die Erkrankung tritt meist im mittleren Lebensalter auf. Obwohl man vermutet, dass die Ursache im Gehirn liegen muss, ist es bisher nicht gelungen, die Gründe zu entschlüsseln. Neurologen behandeln Schiefhals am häufigsten mit Botox-Spritzen.
Peinlich, wenn man auf Ämtern um seine Unterschrift gebeten wird und nicht unterzeichnen kann. Der Betroffene ist nicht etwa Analphabet, ihn plagt ein Schreibkrampf. Dabei versagen die Muskeln der Hand ausschliesslich beim Schreiben; im weiteren Verlauf der Erkrankung können auch Muskelgruppen des Armes hinzukommen. Männer ab Mitte Dreissig sind am häufigsten betroffen.
Beim Stimmbandkrampf sprechen die Betroffenen sehr leise, gepresst und angestrengt, können jedoch oftmals normal singen.
Bei Mund-, Zungen- und Schlundkrampf führen Zuckungen und Krämpfe der Muskeln in der unteren Gesichtshälfte bzw. im Unterkiefer zu bizarren Anspannungen, die zudem heftige Schmerzen mit sich bringen. Das Sprechen und die Nahrungsaufnahme sind stark behindert.
In allen diesen Fällen hat Botulinumtoxin neue Therapiemöglichkeiten in der Neurologie eröffnet.
Ein Lidkrampf (med.: Blepharospasmus) ist ein krampfartiger Lidverschluss, der sehr unangenehm sein und über mehrere Stunden anhalten kann. Bei diesem Krankheitsbild gibt es keine nützlichen Operationen oder Medikamente. Als Therapie der Wahl gelten Botox-Spritzen an mehreren Stellen um das Auge herum. Das führt zur Entspannung der Muskeln, und die Augen öffnen sich wieder. Der Effekt hält in der Regel acht bis vierzehn Wochen an.
1989 wurde Botulinumtoxin von den US-Behörden als Mittel gegen Schielen und Lidzucken offiziell zugelassen. Mit Botox kann man Schielen (Strabismus) korrigieren, doch der Erfolg ist nicht von Dauer. Die Wirkung lässt nach zwei bis drei Monaten wieder nach, und das Auge geht in die Ausgangsposition zurück. Bei Kindern wird die Behandlung mit Botox nicht angewandt, da das direkte Einspritzen in den Augenmuskel, der vorübergehend gelähmt wird, nötig ist. Die Behandlung bietet sich vor allem beim sogenannten Lähmungsschielen (Augenmuskellähmung) an, das sich durch Doppelbilder bemerkbar macht und meist durch Unfälle oder Krankheiten wie Durchblutungsstörungen, Schlaganfälle, Tumoren, Multiple Sklerose oder Aneurysmen verursacht wird.
Bei der Spastik ist die Muskelspannung erhöht, da das harmonische Wechselspiel zwischen Anspannung und Entspannung gestört ist. Es kommt zur Einschränkung der Bewegung und auf Dauer zu Muskelverkürzungen. Dies führt meist zu deutlicher Behinderung. In Deutschland ist die Botox-Behandlung für zwei Arten zugelassen: die Spastik der Hand bzw. des Arms nach Schlaganfall sowie die fokale Spastik nach infantiler Zerebralparese (darunter versteht man Bewegungsstörungen, deren Ursache in einer frühkindlichen Hirnschädigung liegt). Zur Beeinflussung derartiger Spasmen hat sich die Anwendung von Botulinumtoxin als besonders wirksam erwiesen.
Bei einem spastischen Spitzfuss (der u.a. auch Teil einer infantilen Zerebralparese sein kann) wird die Fehlstellung durch eine dauerhafte Verkrampfung der Wadenmuskulatur ausgelöst. Die Betroffenen können nur auf Zehenspitzen laufen. Neben Krankengymnastik oder Operation ist auch die Botox-Spritze in den Wadenmuskel eine Option.
Botox hilft zudem bei gutartiger Prostatavergrösserung, bei einer hyperaktiven Blase nach Rückenmarksverletzung, bei Reizblase und Dranginkontinenz, bei Rissen in der Afterschleimhaut (Analfissuren) und bei Vaginismus (Scheidenkrampf).
Ein empörendes Kapitel in Sachen Botox sind die Tierversuche. Die Frauen und Männer, die auf Hautfaltenglättung stehen, wissen wahrscheinlich nicht, dass (mindestens zur Hälfte) ihretwegen die Gewinnung dieses Stoffes mit qualvollen Tierversuchen verbunden ist. Jedes Jahr sterben eine halbe Million Mäuse.
Wie die «Ärztinnen und Ärzte für Tierschutz in der Medizin» mitteilen, muss der Gehalt an Botox in jeder Produktionseinheit (Charge) immer wieder neu überprüft werden. Weil der Grat zwischen wirksam und giftig bei diesem extrem starken Gift ganz, ganz schmal ist, spritzt man Mäusen das Gift in verschiedenen Dosen in die Bauchhöhle und bestimmt so die nötige Dosis bis 50 Prozent der Tiere tot sind (sog. LD50-Test). Die Tiere erleiden einen qualvollen Tod durch Nervenlähmungen, bis sie schliesslich an Atemlähmung ersticken. Dies kann drei bis vier Tage dauern. Zwar sind Tierversuche für Kosmetika in der EU verboten, doch gilt Botox rechtlich als Arzneimittel, und da sind Tests an Versuchstieren erlaubt.
Der US-Hersteller Allergan hat in zehnjähriger Forschungsarbeit einen tierversuchsfreien Test entwickelt, der 2011 in den USA und Kanada, 2012 auch in der EU anerkannt wurde. Die Crux ist aber, dass, erst wenn sämtliche Herstellerfirmen vergleichbare Tests entwickelt haben, der (noch vorgeschriebene) Mäuse-Versuch im Europäischen Arzneibuch gestrichen werden kann.



