A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.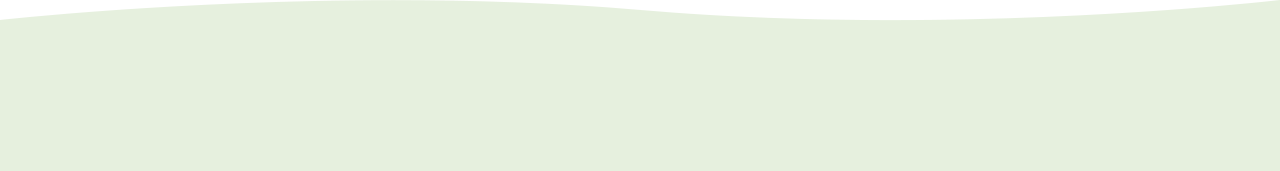
Hochbegabt – Förderschub für Überflieger
Ein hochbegabtes Kind ist der Traum vieler Eltern. Doch wer eines hat, weiss: So ein «Wunderkind» ist kein glamouröses Geschenk des Lebens, sondern eine komplexe Herausforderung.
Autorin: Petra Horat Gutmann, 11/16
Sie legen mit drei Jahren 100-teilige Puzzles, lernen in der Schule doppelt so rasch wie andere oder gehen mit 15 zur Uni. Superschlaue «Wunderkinder» gibt es auf der ganzen Welt, auch in unseren Breitengraden. Kinder wie zum Beispiel der achtjährige Juri Luternauer aus Rothenburg LU, der seit seinem vierten Lebensjahr Bücher verschlingt und heute auf Matura-Niveau Physik lernt. Oder wie der 14-jährige Bastian Eichenberger, der neun Sprachen spricht und an der Universität Freiburg (D) Chemie studiert.
Statistisch betrachtet gehören Juri und Bastian zu einer hauchdünnen Elite: Gerade mal zwei Prozent der Bevölkerung haben wie sie einen IQ von über 130, der zum Tragen der Bezeichnung «hochbegabt» berechtigt. Das ist eine hohe Messlatte, unerreichbar für viele Eltern, die von einem superintelligenten Kind träumen. Schliesslich gilt: Wer schlau ist, hat Erfolg. Und wer wünscht dem eigenen Nachwuchs keinen Erfolg?
Zum Glück ist die Sache mit der Intelligenz nicht ganz so einfach. Das zeigt ein Blick auf die grosse weite Welt, wo zahlreiche Menschen leben, die sehr intelligent sind, aber auf unterschiedliche Weise. Ein Grund, weshalb Forscher wie zum Beispiel Howard Gardner, Professor für Psychologie in Harvard, mindestens acht Ausdrucksformen menschlicher Intelligenz beschreiben, von der sprachlichen und mathematischen über die visuell-räumliche bis zur sozialen Intelligenz und weitere mehr.
Was nun das Etikett der «Hochbegabung» betrifft, wird für dieses lediglich die kognitive Intelligenz berücksichtigt. Einfach, weil diese sprachlich-mathematisch orientierte Intelligenz besonders gründlich erforscht ist und sich die damit verbundenen Fähig- keiten zuverlässig messen lassen, also etwa das analytisch-logische Denken, die Sprachbeherrschung und das Gedächtnis.
Das sind Fähigkeiten, wie sie gut ausgeprägt oder gar hoch entwickelt bei vielen erfolgreichen Menschen zu finden sind, nicht nur bei Harvard-Absolventen und Hochschulprofessoren, sondern auch bei Heerscharen von Geschäftsleuten, Handwerkern, Sportlern und vielen weiteren ganz normalen Menschen, von denen wiederum nur die wenigsten einen IQ von 130 plus besitzen.
Man mag sich deshalb fragen: Wozu denn der ganze Hype um die Hochbegabung? Dass Hochbegabung seit Jahren ein heiss diskutiertes Thema ist, hat damit zu tun, dass die Förderung hochbegabter Kinder jahrzehntelang vernachlässigt wurde und die Defizite noch nicht vollumfänglich aufgearbeitet sind. Tatsächlich gibt es immer wieder kognitiv hochbegabte Kinder, die an der Volksschule einen langen Leidensweg durchlaufen. Weil sie die Schule aufgrund ihrer Hochbegabung als «langweilig» empfinden oder von anderen Kindern ausgegrenzt werden.
Das ist auch für die Eltern dieser Kinder eine Herausforderung. Hinzu kommt die private Belastung, zum Beispiel, weil es gar nicht so einfach ist, einem hochbegabten Sprössling ständig adäquates «Kopffutter» zu liefern. Oder weil nicht jede Mutter entzückt ist, wenn sie ständig mit detailgenauen Fakten beliefert wird, etwa beim Gurkenschnetzeln in der Küche, wo das Kind zum klugen Vortrag über die genauen Masse der grössten Gurke ausholt, die je gezüchtet wurde.
Wird der Leidensdruck zu gross, suchen die Eltern meist Hilfe im schulischen Umfeld. Die Crux dabei: «Das Verständnis für die Bedürfnisse hochbegabter Kinder variiert von Gemeinde zu Gemeinde. Es kommt immer wieder vor, dass Lehrpersonen, Schulleiter oder Schulbehörden den Eltern hochbegabter Kinder empfehlen, eine langsamere Gangart einzuschlagen oder ihren Ehrgeiz zu zügeln», sagt Yolanda Pfaff, Beraterin bei der Stiftung für hochbegabte Kinder in Zürich, wo jedes Jahr Hunderte Eltern von hochbegabten Kindern anrufen. «Dabei wird häufig übersehen, dass zusätzliche Förderung für diese Kinder kein Stress ist, sondern ein Bedürfnis und eine Notwendigkeit, damit sie sich gesund entwickeln können.»
Der umfassende Gesundheits-Newsletter von A.Vogel erscheint 1 x pro Monat und enthält Informationen, Tipps, Wettbewerbe und vieles mehr – rund um alle Gesundheitsthemen.
Mitunter werde den Eltern auch nahegelegt, ihren Kindern mehr Sozialkompetenz beizubringen. Dabei zeige die Erfahrung, dass sich die zwischenmenschlichen Probleme «oft rasch glätten, sobald das Kind ein Umfeld erhält, wo es seinen grossen Wissensdrang und seine Lernfreude ausleben darf», erklärt Yolanda Pfaff.
Die meisten pädagogischen Experten sind sich einig, dass hochbegabte Kinder und Jugendliche eine Förderung verdienen, die ihren Bedürfnissen entspricht. Fragt sich nur, welche? Ein Patentrezept gibt es nicht, aber eine grundlegend wichtige Erkennt- nis: «Man sollte individuell auf jedes hochbegabte Kind eingehen und bei der Förderung viele Umgebungsfaktoren mitberücksichtigen», sagt Dr. Giselle Reimann, Begabungs-Expertin am Zentrum für Entwicklungs- und Persönlichkeitspsychologie ZEPP der Universität Basel.
Oft lasse sich eine befriedigende Schulsituation bereits mit kleinen Änderungen erreichen, etwa, indem das Kind in der Schule interessante Ersatzaufgaben bekomme. «Für andere Kinder kann das Überspringen einer oder mehrerer Klassen optimal sein», weiss Giselle Reimann. «Wieder andere fühlen sich am wohlsten, wenn sie ein bestimmtes Fach auf einer höheren Schulstufe besuchen oder sich regelmässig in einer klassenübergreifenden Gruppe von Hochbegabten austauschen dürfen.» Manche Hochbegabte seien dagegen in einer Spezialschule für Hochbegabte am besten aufgehoben, etwa weil sie sich dort sozial besser akzeptiert fühlten oder eine positivere Einstellung zur Schule entwickeln könnten.
Nun sind solche Talentschulen jedoch nicht für alle erschwinglich und ein Stipendium der öffentlichen Hand schwer zu bekommen. Umso erfreulicher ist es, dass in den letzten Jahren an rund 50 Schweizer Volksschulen eine Form der Begabtenförderung ein- geführt wurde, die Beachtung verdient. Zu ihnen gehört die mit dem Lissa-Preis (www.lissa-preis.ch) ausgezeichnete Primarschule in Untereggen SG samt angegliedertem Kindergarten.
Das Herzstück der Begabungsförderung in Untereggen ist das «Enrichment» (engl. für Anreicherung): Dieses sieht vor, dass jedes Kind – vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse – jede Woche während zwei Lektionen ein frei gewähltes Projekt professionell umsetzen darf.
«Wir gehen davon aus, dass jedes Kind besondere Talente hat», erklärt Schulleiter Thomas Allmann. «Die Projekte helfen den Kindern, ihre individuellen Interessen und Begabungen zu entdecken und zu entfalten.» Die Lehrer helfen den Kindern Schritt für Schritt bei der erfolgreichen und fristgerechten Umsetzung der Projekte. Einerseits, indem sie Kontakte zu Fachleuten vermitteln – vom Berufsmusiker über die Grafikerin bis zu Förster, Koch und Kranführer. Andererseits, indem sie mit den Schülern Lerntechniken und Fertigkeiten trainieren, die für die Realisierung anspruchsvoller Projekte wesentlich sind – wie Mindmap, Recherchen mit der Suchmaschine, Schreiben von Zusammenfassungen und mehr.
Ob Bauernhofbesuch, Bildergalerie, Detektivgeschichte oder Modellflugzeug: Am Ende präsentiert jedes Kind das fertige Projekt vor versammelter Klasse. Danach geben die Mitschüler Rückmeldungen zur gezeigten Leistung. «Auch das ist wichtig», sagt Thomas Allmann. «Weil es den Kindern hilft, mit Kritik umzugehen und sich immer wieder auf Neues einzulassen.»
Überhaupt wird in Untereggen grosser Wert auf emotionale und soziale Kompetenzen gelegt – also auf das Fördern von Qualitäten wie Ausdauer, Selbstvertrauen, Motivation, Einfühlungsvermögen und Stressbewältigung.
Das ist auch im Sinne der Begabungs-Expertin Giselle Reimann, die sagt: «Die Förderung hochbegabter Kinder sollte nicht in erster Linie auf super Leistungen abzielen, sondern darauf, die Begabung und Persönlichkeit des Kindes harmonisch zu entwickeln.» Weil Begabung alleine oder ein IQ von 130 eben kein Garant für ein erfolgreiches Leben sind, geschweige denn für ein glückliches.
Emotionale Intelligenz: Beobachten, was man fühlt, darüber sprechen oder es beschreiben (Tagebuch), die Gefühle und Stimmungen anderer Menschen (Eltern, Geschwister usw.) be- wusst wahrnehmen, z. B. indem man ihre Gestik und den Gesichtsausdruck deuten lernt.
Körperlich-kinästhetische Intelligenz: Basteln, nähen, technische Geräte reparieren, eine neue Sportart oder Tanzform lernen, einen Mannschaftssport betreiben.
Soziale Intelligenz: In einer Kinder- oder Jugend- gruppe mitmachen oder eine Gruppe anführen, eine Diskussion leiten, anderen helfen (z. B. den Eltern in Haus und Garten), Babysitten, mit einem unbekannten Kind ein Gespräch beginnen (Tram, Bus, Schulweg).
Mathematische Intelligenz: Strategiespiele am Tisch oder auf dem Computer machen, komplizierte Rechnungen lösen, ergründen, wie man etwas voraussagen kann (z. B. Wetter), bekannte Phänomene genau verstehen lernen (z. B. warum es im Winter kalt ist), ein Fahrzeug bauen. Musikalische Intelligenz: Ein Lied komponieren, ein Musikinstrument spielen, in einem Chor mitsingen.
Naturalistische Intelligenz: Tiere beobachten, pflegen oder trainieren, einen Garten anlegen, die Sterne beobachten, herausfinden wie der Körper funktioniert, Pflanzen und Insekten sammeln und bestimmen.
Sprachliche Intelligenz: Geschichten, Gedichte oder Liedertexte erfinden, Bücher lesen und eine Zusammenfassung schreiben, Fremdsprachen lernen, einen Vortrag halten.
Visuell-räumliche Intelligenz: Etwas konstruieren oder entwerfen (Lego-Haus, Kleidungsstück), schön gestalten oder dekorieren, etwas nach Plan zusammensetzen, selbstständig den Weg finden, fotografieren, malen, zeichnen, modellieren.



