A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.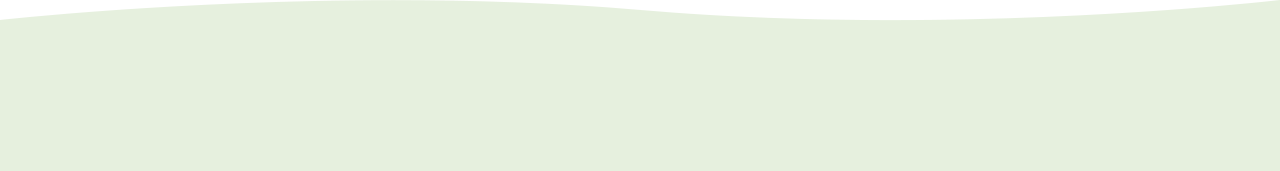
Kinder: Empathie fördern
Weichen fürs Leben stellen
Soziale Kompetenzen sind eine Quelle für Glück und Erfolg. Erziehung kann eine Menge dazu beitragen, dass aus Kindern selbstbewusste und einfühlsame Erwachsene werden.
Autorin: Gisela Dürselen 6/16
- Soziale Entwicklung entscheidend
- COCON-Studie: Sozialverhalten und psychisches Wohlbefinden bestimmen auch Schulleistungen
- Fördern und fordern
- Phasen fürs Lernen
- Hochsensibles Jugendalter
- Jetzt zählt auch «Haltung»
- Neue Qualifikationen gefragt
- Das «Making Caring Common»-Projekt: Grundregeln für soziales Lernen
Einzelkämpfer haben es schwer, besonders im Arbeitsleben. Denn gefragt sind neben fachlicher Eignung vor allem soziale Kompetenzen: Initiative ergreifen und Verantwortung übernehmen, kooperieren und Konflikte lösen. Sich einerseits behaupten können – und andererseits Beziehungen pflegen. Niemandem sind all diese Fähigkeiten angeboren. Darum müssen sie trainiert werden. Neurowissenschaftler sprechen von Netzwerken im Gehirn, die sich beim kleinen Kind aufbauen und durch Erfahrung verstärken oder wieder verschwinden – je nachdem, ob eine Verbindung genutzt und aktiviert wird oder nicht. Bestimmte Netzwerke sind für soziales Handeln zuständig, und diese können schon früh entscheidende Weichen fürs Leben stellen: Ob ein Kind beliebt ist oder gemobbt wird, ob es gerne zur Schule geht oder eine Verhaltensstörung oder Sucht wie Rauchen entwickelt, hängt Wissenschaftlern zufolge auch mit der sozialen Entwicklung zusammen.
Eine wichtige Studie, die sich mit der psychosozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen befasst, heisst «COmpetence and CONtext» (COCON) und wird am Jacobs Center for Productive Youth Development an der Universität Zürich durchgeführt. Laut COCON-Befunden wirken sich Sozialverhalten und psychisches Wohlbefinden auf die Schulleistungen aus: «Sie beeinflussen beispielsweise die Fertigkeiten von Schulkindern, sich in der Klasse zu integrieren oder sich auf Lehrinhalte zu konzentrieren», sagt Prof. Marlis Buchmann, Projektleiterin der COCON-Studie.
Auch die psychische Gesundheit werde deutlich von der sozialen Entwicklung beeinflusst. In einer Welt, in der sich Lebensbedingungen, Werte und Familienformen verändern, ist Kindererziehung trotz bester Vorsätze nicht leicht, stellt die Schweizerische Vereinigung der Elternorganisationen fest. Es herrsche Leistungsdruck in Familie, Schule und Beruf und herkömmliche Erziehungsstile mit Gehorsam und Anpassung helfen nicht mehr weiter. Was also können Eltern tun, um ihre Kinder zu stärken?
Wichtig ist das viel zitierte Urvertrauen, das durch verlässliche Beziehungen entsteht. In der COCON-Studie spielt in allen untersuchten Altersstufen von sechs bis 21 Jahren die emotionale Qualität der Eltern-Kind-Beziehung eine wichtige Rolle. Eltern wirken offenbar als Vorbilder – auch dadurch, wie sie als Paar miteinander reden und umgehen. Es ist also nicht egal, ob daheim offen über Gefühle geredet wird oder diese ein Tabu sind, ob Konflikte fair ausgetragen oder unter den Teppich gekehrt werden und ob ein Kind darauf vertrauen kann, in allen Situationen geliebt und angenommen zu sein oder nur unter bestimmten Bedingungen.
Neben der Bindung ist das Mass an Freiheit und Autonomie entscheidend. Darum empfehlen Prof. Buchmann und die Vereinigung der Elternorganisationen den partizipativen Erziehungsstil. Dieser zeichnet sich laut Prof. Buchmann aus durch «hohe Wertschätzung und emotionale Zuwendung mit Freiräumen einerseits und durch klare Regeln, verknüpft mit Konsequenzen andererseits». Die Erziehenden achten dabei auf «Altersangemessenheit, um so den Bedürfnissen und Fertigkeiten der Kinder zu entsprechen».
Die Schlüsselbegriffe sind «fördern» und «fordern»: Eltern trauen ihrem Kind etwas zu und unterstützen seine Selbständigkeit – erwarten dafür aber auch etwas. Den Kindern kommt eine solche Erziehung zugute, wenn sie in Kindergarten und Schule kommen. Denn wie sie entscheidende Übergänge in neue Lebensumstände meistern, hängt laut COCON-Studie massgeblich von ihren sozialen Fähigkeiten ab.
Obwohl sich das menschliche Gehirn zeitlebens verändern kann, gibt es der Hirnforschung zufolge sensible Phasen fürs Lernen. Die Kindergartenzeit ist eine solche wichtige Zeit für soziales Lernen. Denn ab einem Alter von etwa vier Jahren entwickelt sich die Fähigkeit, andere zu verstehen und sich in sie hineinzuversetzen.
Die COCON-Studie bescheinigt Kindergartenkindern im Durchschnitt mehr Mitgefühl als jenen Kindern, die ausschliesslich zu Hause betreut werden. Das Lernen von Mitgefühl geschehe nur im sozialen Rahmen und hänge stark von den Erfahrungen ab, die Kinder in Beziehungen mit anderen Menschen machen, so Prof. Buchmann. «Mitgefühl fördern insbesondere Erfahrungen, die Benachteiligung, sozialen Ausschluss oder Traurigkeit zum Gegenstand haben und für Kinder nachvollziehbar machen.» Dazu bietet eine Kindergruppe mit vielen Sozialkontakten ein ideales Übungsfeld.
Entgegen früherer Annahmen ist die soziale Entwicklung damit noch nicht abgeschlossen. Laut der COCON-Studie steigt insbesondere das Mitgefühl zwischen der mittleren Kindheit (sechs Jahre) und Adoleszenz (15 Jahre) steil an, um dann bis ins junge Erwachsenenalter (21-Jährige) relativ stabil zu bleiben.
Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen von Prof. Sarah-Jayne Blakemore vom Londoner University College, die 2015 für ihre Studie den Zürcher «Klaus J. Jacobs-Research-Prize» erhielt. Laut Prof. Blakemore ist das Jugendalter eine hochsensible Phase für soziales Lernen, weil sich in dieser Zeit die Gehirnregion herausbildet, die für soziale Prozesse zuständig ist. Das hat Auswirkungen auf die schulische Erziehung.
Der zweite «Klaus J. Jacobs-Preis» in der Kategorie Best Practice ging an die private Gesamtschule Unterstrasse in Zürich mit ihrem Gründer und Leiter Dieter Rüttimann. Soziale Kompetenzen sind an dieser Schule ein eigenständiges Fach, und Kinder lernen dort in altersgemischten Gruppen. Sie unterstützen sich gegenseitig und sind – je nach Alter – einmal Lehrer und ein anderes Mal Lernende; die Lehrperson selbst wird zu einer Art Begleiter.
Der umfassende Gesundheits-Newsletter von A.Vogel erscheint 1 x pro Monat und enthält Informationen, Tipps, Wettbewerbe und vieles mehr – rund um alle Gesundheitsthemen.
Selbständiges Lernen in gemischten Gruppen ist nicht unumstritten. Genauso wie der Begriff «Kompetenz» im Unterricht, was die Debatten um den Lehrplan 21 gezeigt haben. Der Lehrplan 21 ist Vorlage für die kantonalen Lehrpläne und vereinheitlicht die Bildungsziele der Volksschule in der deutschsprachigen Schweiz.
Erstmals wurden darin die traditionellen schulischen Ziele «Wissen» und «Können» durch die Kategorien «Haltungen» und «Einstellungen» ergänzt. Letztere wiederum werden als Kompetenzen wie «Selbstreflexion, Eigenständigkeit, Beziehungsfähigkeit und Konfliktfähigkeit» beschrieben. Kritiker betonen die Wichtigkeit einer breiten, nachweisbaren Bildung und fragen: Wie sind Kompetenzen messbar? Befürworter monieren, Kinder würden zu früh auf reine Wissensinhalte getrimmt; wichtige Alltagsfähigkeiten wie soziales Verhalten träten in den Hintergrund.
Sicher ist, dass der gesellschaftliche Wandel auch die Schulen vor neue Herausforderungen stellt. So gibt es in den Klassen mehr Vielfalt durch Migration, aber kaum noch Kinder aus einer Grossfamilie, die einst ein natürliches Übungsfeld für soziales Lernen war. Prof. Buchmann meint, ältere Geschwister, die schon zur Schule gehen, könnten als Wegbereiter einem jüngeren Kind beim Schuleintritt helfen. Doch was ist, wenn in der ersten Klasse fast nur Einzelkinder sitzen?
Orte ausserhalb der Familie, Betreuungseinrichtungen, Freunde und neue Medien gewinnen an Bedeutung. Lehrer übernehmen mehr Erziehungsaufgaben als früher und brauchen dafür neue Qualifikationen. Etwa solche, wie sie die Pädagogische Hochschule (PH) Luzern seit 2013 als Weiterbildung anbietet: ein achtsamkeitsbasiertes Training, bei dem Pädagogen ihre Selbst- und Fremdwahrnehmung stärken sowie Perspektivenwechsel und eine empathische Haltung einüben. Damit trainieren nun die Lehrer soziale Kompetenz und geben diese im Unterricht weiter.
Auch in den USA sind soziale Kompetenzen ein Thema. Im Rahmen des «Making Caring Common»-Projekts der Harvard Universität haben Wissenschaftler von 2013 bis 2014 insgesamt 10000 amerikanische Kinder und Jugendliche zu ihren sozialen Werten interviewt. 80 Prozent der Befragten stellten Leistung und persönliches Glück über die Fürsorge für andere – und zwar deshalb, weil sie annehmen, dass ihre Eltern dies ebenfalls tun.
Eine intakte Gesellschaft brauche Menschen, die sich fürs Gemeinwohl einsetzen – besonders in Zeiten mit Problemen, die nur gemeinsam zu lösen sind, lautet die zentrale These der Harvard-Wissenschaftler. Kinder zu fürsorglichen, respektvollen und moralischen Menschen zu erziehen sei schon immer harte Arbeit gewesen. Dennoch könne sie jeder tun – und schliesslich sei keine andere Aufgabe lohnender als diese.
Zum «Making Caring Common»-Projekt der Harvard-Universität gehört eine Liste von Empfehlungen, mit denen Eltern die soziale Entwicklung ihrer Kinder fördern können. Eingeflossen sind Ergebnisse anderer Studien sowie Erfahrungen mehrerer Organisationen. Eine Zusammenfassung:
Tägliche Übung:
Freundlichkeit und Fairness lassen sich mit einfachen Dingen erlernen – zum Beispiel mit Pflanzen giessen und einem Freund bei der Hausaufgabe helfen.
Prioritäten setzen:
Soziale Verantwortung sollte Priorität haben, auch gegenüber anderen Personen. Eltern stellen dies klar, indem sie sich etwa beim Lehrer nicht nur nach Noten, sondern auch nach dem Verhalten ihrer Kinder erkundigen.
Positives Vorbild:
Eltern brauchen nicht alle Antworten zu haben und müssen auch nicht perfekt sein, sollten aber durch Beispiel führen. Kinder, die ihren Eltern vertrauen und sie respektieren, wollen ihnen nacheifern. Darum ist es gut, wenn sich Eltern für andere Menschen engagieren.
Verantwortung:
Eltern sollten Verantwortung übernehmen und ehrlich sein. Sich zum Beispiel fragen, welche Botschaften und Werte sie jenseits ihrer Worte durch ihr Tun vermitteln. Haben Eltern einen Fehler gemacht, können sie mit den Kindern darüber sprechen und ihnen ihr Handeln erklären.
Perspektivenwechsel:
Kinder sollten lernen, verschiedene Perspektiven einzunehmen und sowohl das einzelne Detail als auch das grosse Ganze zu sehen. Eltern können ihre Kinder dazu ermutigen, anderen gut zuzuhören und die Belange von Schwächeren zu beachten – etwa die eines Kindes, das neu in der Klasse ist.
Gefühle managen:
Eltern sollten ihren Kindern dabei helfen, mit unangenehmen Gefühlen wie Ärger und Wut umzugehen, weil diese in schwierigen Situationen oft überwältigend sind und eine positive Lösung verhindern. Eltern können ihren Kindern sagen, dass alle Gefühle okay sind, aber dass es mehr oder weniger konstruktive Arten gibt, diese auszudrücken.



