A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.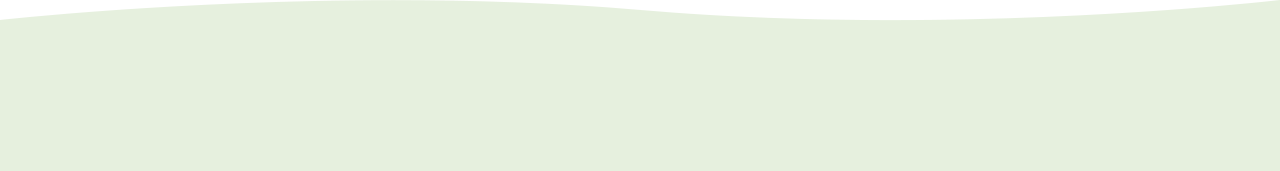
Klimawandel begünstigt den Selenmangel
Rund eine Milliarde Menschen nimmt zu wenig Selen auf. Mit ein Grund dafür ist der Klimawandel. Zu diesem Schluss kommen Wissenschaftler der ETH Zürich nach der Auswertung von über 30 000 Bodenproben.
Das Ergebnis: Den grössten Einfluss auf die Selenkonzentration im Boden haben Niederschläge sowie das Verhältnis zwischen Niederschlag und Verdunstung. Je höher der pH-Wert und die Sauerstoffverfügbarkeit und je niedriger der Anteil an Ton und organischem Kohlenstoff sind, desto weniger Selen ist im Boden. Trockene, basische Böden mit wenig Ton enthalten daher auch weniger Selen.
In Gebieten mit wenig bis mittlerem Niederschlag und hohem Tonanteil ist ein hoher Selengehalt am wahrscheinlichsten. Die Forscher schätzen, dass bis Ende des Jahrhunderts auf zwei Dritteln der landwirtschaftlich genutzten Flächen weltweit mit einem Selenverlust von rund neun Prozent im Vergleich zu den Jahren 1980 bis 1999 zu rechnen ist.
Selen ist ein essenzielles Spurenelement und Bestandteil einiger Enzyme, die z.B. für die Bildung von Schilddrüsenhormonen zuständig sind. Darüber hinaus wirkt Selen antioxidativ und bindet freie Radikale. Ein grosser Mangel (z.B. aufgrund von starkem Blutverlust oder nach krankheitsbedingter Ernährung durch eine Sonde) kann zu Herzmuskelschwäche sowie zu rheumatischen Erkrankungen führen.
Der Selengehalt von Lebensmitteln hängt stark vom Zustand der Böden und des Tierfutters ab. Schweizer Böden sind, wie in Deutschland, Dänemark oder Finnland, eher selenarm. Am meisten Selen enthält die Paranuss (1,9 mg auf 100 g), aber auch in Fleisch und Innereien, Thunfisch, Käse und Eiern sowie in Getreide und Hülsenfrüchten steckt das Spurenelement. Selen ist leicht flüchtig, daher sollten entsprechende Speisen mit wenig Flüssigkeit und bei niedrigen Temperaturen zubereitet werden.
Die täglich benötigte Menge an Selen beträgt:
- Säuglinge: 5 bis 20 Mikrogramm
- Kinder: 20 bis 60 Mikrogramm
- Erwachsene: 30 bis 70 Mikrogramm


