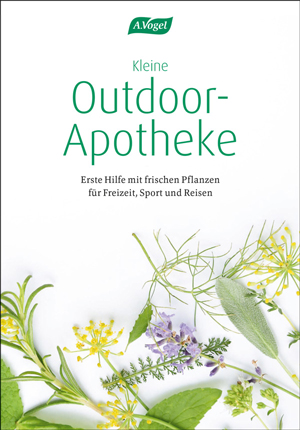A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.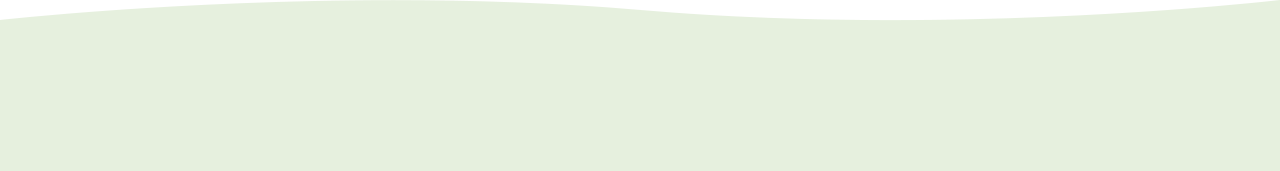
Vorsicht bei Riechstörungen
Wie bei allen unsere Sinnen, birgt auch der Verlust des Geruchssinns Risiken
Ob aufgrund des Alters oder anderer Ursachen: Lässt der Geruchssinn nach, kann das im Alltag zu erheblichen Beeinträchtigungen führen. Experten setzen auf ein spezielles Riechtraining.
Autorin: Andrea Pauli, 05/19
Woran schnuppern Sie gern? An duftenden Rosen, einem frischgebrühten Kaffee oder an edlem Parfüm? Gerüche werden direkt ins Gehirn weitergeleitet, unter anderem in das Gefühls- und Erinnerungszentrum, wo sie unmittelbar Emotionen auslösen. Schon Säuglinge können riechen; beim Geruch fauler Eier verziehen sie das Gesicht, beim Duft einer Banane entspannen sie es. Wie wir Gerüche bewerten, lernen wir dann im Lauf der Kindheit durch Erfahrungen und die Reaktionen unseres Umfeldes. Kulturübergreifend ist eine angeborene Abscheu gegen Gerüche, die durch Verdorbenes und Gefährdendes verursacht werden – das ist eine dem Menschen mitgegebene Warnfunktion.
Dieser wichtige «Wegweiser» lässt leider im letzten Lebensdrittel nach – je älter, desto schlechter der Geruchssinn, dies ist ein schleichender Prozess. Männer riechen zudem schlechter als Frauen. Doch es gibt noch zahlreiche andere Ursachen. Grund für eine Riechstörung können anatomische Besonderheiten wie Nasenpolypen oder Verkrümmungen der Nasenscheidewand sein. Hier wird in der Regel zu einem chirurgischen Eingriff geraten. Bei jeder sinunasalen Operation, die als «Nebenziel» ein verbessertes Riechvermögen anstrebt, muss jedoch auch mit einer möglichen Verschlechterung gerechnet werden. Das ist umso wahrscheinlicher, je besser das Ausgangsriechvermögen des Patienten war.
Zu einem Verlust des Geruchssinns führen können auch: (infektiöse) Entzündungen im Bereich der Nase oder Nasennebenhöhlen, Schädel-Hirn-Traumen oder eine akute oder chronische toxische Schädigung der Riechschleimhaut, z.B. durch Formaldehyd, Tabakrauch, Pestizide oder Kohlenmonoxid. Gewisse Medikamente, z.B. Antibiotika, können als Nebenwirkung Riechstörungen verursachen; diese verschwinden in der Regel nach dem Absetzen. Im Rahmen einer krebstherapeutischen Strahlentherapie machen sich bisweilen auch Geruchsbeeinträchtigungen bemerkbar. Weitere Gründe könnenTyp-2-Diabetes, Schilddrüsenunterfunktionen oder Epilepsie sein, ebenso Depressionen und schizophrene Psychosen sowie Nieren- und Leberkrankheiten.
Riechsstörungen sind zudem ein Begleitsymptom vieler neurodegenerativer Erkrankungen, wie aufschlussreiche Untersuchungen der vergangenen Jahre belegen. In der Früherkennung und Differenzialdiagnose des Parkinson-Syndroms und der Alzheimer-Demenz gewinnen sie darum zunehmend an Bedeutung. Man nimmt an, dass Riechstörungen den motorischen Störungen bei Parkinson um etwa vier bis sechs Jahre vorausgehen. (Wobei nicht jeder, der eine Riechstörung hat, auch eine Demenz oder Parkinsonerkrankung entwickelt!)
Eine Studie aus 2017 schätzt, dass 3 bis zu 20 Prozent der Bevölkerung in unterschiedlichem Ausmass von Beeinträchtigungen des Geruchssinns betroffen sind. Das kann fatale Auswirkungen haben. Mit einer Verminderung des Geruchssinns verschlechtert sich nicht nur zugleich der Geschmackssinn – es geht auch ein erhöhtes Risiko damit einher. Wer verdorbene Speisen weder riecht noch schmeckt (die Nase leistet beim Schmecken die Feinarbeit!), kann sich davor auch nicht in Acht nehmen. Wer Brandgeruch nicht wahrnimmt, kann sich nicht vor Feuer schützen. Nicht zuletzt hat eine Einschränkung des Geruchssinns auch soziale Folgen: Wer nicht mehr wahrnimmt, ob er selbst oder seine Kleidung eine Wäsche nötig haben, wird unsicher und schottet sich womöglich ab.
Experten weisen deshalb immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, eine solche sensorische Störung von therapeutischer Seite möglichst zeitig anzugehen und die Betroffenen über die Risiken aufzuklären.

Die HNO-Ärztin wird sich zuerst einen Eindruck davon verschaffen, wie stark die Störung der Geruchswahrnehmung ist und mögliche Grunderkrankungen abfragen. Danach steht eine Untersuchung der Nase, des Nasenrachens und der Riechspalte an.
Bestandteil der Diagnostik sind zudem Riechtests. Man gibt dem Patienten mehrere Geruchsstoffe vor, meist in Form sogenannter Sniffin' Sticks (die Ähnlichkeit mit Filzstiften haben), an denen drei Sekunden gerochen wird. Die Ärztin prüft die Fähigkeit des Betroffenen, verschiedene Düfte zu identifizieren und voneinander zu unterscheiden: Anhand von Listen mit je vier Begriffen sollen sie benannt werden.
Mit einem weiteren Test bestimmt man die Riechschwelle. Dazu werden wiederholt auf- und absteigende Konzentrationen desselben Duftstoffes dargeboten. Die zuletzt als richtig erkannte Konzentration wird als Wahrnehmungsschwelle festgelegt.
Diese «subjektiv» genannten Tests setzen die Mitarbeit der Patienten voraus – bei Kindern oder dementen Personen sind die Messungen unter Umständen nur schwer durchführbar. Dann kann es sinnvoller sein, «objektive» Messmethoden zu verwenden, die nicht der aktiven Mitwirkung des Patienten bedürfen (z.B. ein Elektro-Olfaktogramm). Objektive Messmethoden sind relativ aufwendig und werden nur in spezialisierten Zentren angeboten.
Die Grundlage aller Therapien bei Riechstörungen bildet eine Besonderheit unseres Geruchssinnes: die Plastizität. Ein Prozent der Neuronen werden ausgetauscht, die Sinneszellen der Riechschleimhaut regenerieren sich alle vier bis sechs Wochen – und können erfolgreich stimuliert werden. Untersuchungen zeigen: Tägliches Trainieren mit Düften hat einen wirksamen Effekt auf das Riechvermögen!
In einer Studie am Interdisziplinären Zentrum für Riechen und Schmecken des Dresdner Universitätsklinikums Carl Gustav Carus beispielsweise «haben 30 Prozent unserer Probanden innerhalb von fünf Monaten eine Verbesserung des Geruchssinns erreicht. In der Vergleichsgruppe ohne Training waren das nur 7 bis 15 Prozent», fasst Prof. Thomas Hummel die Ergebnisse seines Instituts zusammen.
In einer Multicenterstudie zeigte sich, dass durch ein regelmässiges Riechtraining mit überschwelligen Düften (= hohe Duftkonzentration) Fälle von Riechstörungen nach einer Infektion positiv beeinflusst werden können, erklärt Prof. Antje Welge-Lüssen. «Dieses Riechtraining wird an der HNO-Klinik des Universitätsspitals Basel regelmässig eingesetzt.»
Die Duftstifte, die bereits bei der Diagnose eine Rolle spielen, kommen auch beim Riechtraining zum Einsatz (oder es werden Riechfläschchen genutzt). Bei infektbedingten Riechstörungen beispielsweise würde man mit vier Gerüchen jeweils drei Schnüffelserien morgens und abends durchführen. Dabei ist Geduld gefragt: Das ärztlich angeleitete Training sollte mindestens vier Monate lang durchgehalten werden, um einen Erfolg zu spüren.
Übrigens: Je mehr man schnuppert und je mehr man den Riechkolben (Bulbus olfactorius) fordert, umso grösser wird er. Auch «Normalriecher» werden durch Üben sensibler für bestimmte Düfte. Parfumeure und Weinexperten wissen um diesen Effekt und müssen schon berufsbedingt ihre Nase zum Instrument machen bzw. ihr Geruchsgedächtnis regelmässig trainieren.
Im Gehirn triggert das Riechtraining zudem eine Umorganisation der zuständigen Areale, fand Prof. Veronika Schöpf von der Universität Graz heraus. Sie demonstrierte mithilfe einer Magnetresonanztomografie (MRT), wie mit wachsender Empfindlichkeit für Düfte auch die fürs Riechen zuständigen Netzwerke im Gehirn aktiver wurden.
Je kürzer eine Riechstörung erst vorliegt, desto bester scheinen die Ergebnisse des Trainings zu sein.

Mitunter kommt es aber auch zu einer Spontanerholung des Riechvermögens nach traumatischen oder viralen Störungen ganz ohne Training. Wobei die Faktoren jugendliches Alter, Nichtraucher, weibliches Geschlecht und gleiche Riechfunktion auf beiden Seiten dabei ausgesprochen förderlich sind.
Eine gross angelegte Studie gibt Hinweise darauf, dass das Riechtraining allerdings Erfolgsquoten erzielt, die deutlich über der Spontanheilungsrate liegen.