A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.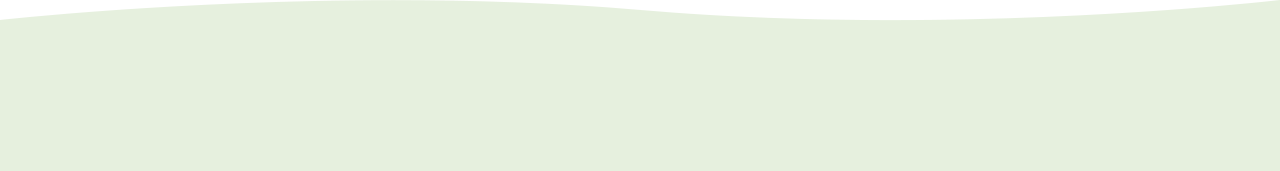
Pflanzenheilkunde (Phytotherapie)
Zwischen Tradition und Wissenschaft, Erfahrung und Forschung
Pflanzen sind die Basis der Heilkunst. Die Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) hat die Menschen auf der ganzen Welt in ihrer gesamten Geschichte begleitet. Aus unentwegtem Suchen, Erproben und Prüfen entwickelte sich in allen Kulturkreisen der Erde eine empirische Wissenschaft. Heute haben viele Pflanzen ihren gesicherten Platz in der Heilkunde und werden in einem breiten therapeutischen Spektrum angewendet.
Autorin: Ingrid Zehnder-Rawer
- Die Natur ist die Apotheke
- Säfte und Signale
- Klöster und Kräuterbücher
- «Knoblauch, Zwiebeln, Wein und Ochsengalle...»
- Pflanzenbezeichnungen vereinheitlicht
- Die «moderne» Pflanzenheilkunde
- (Zu)viele Pflanzen vernachlässigt
- Keine Aussenseiter-Methode
- Das Geheimnis liegt in der naturgegebenen Vielfalt
- Das Ganzheitsprinzip Alfred Vogels
- Abhängig von den «Launen» der Natur
- Über 32'000 Pflanzen mit medizinischem Nutzen
Alfred Vogel (1902 – 1996), der bedeutende Schweizer Heilpflanzenforscher und Naturarzt, betonte gern, dass die Natur ein grosses und weises Repertoire an pflanzlichen Heilmitteln zu Verfügung stellt. Das ist sicher richtig, doch darf man nicht übersehen, dass, solange die Menschen die «Apotheker» sind, Irrtümer und Irrwege nicht ausgeschlossen werden können. Denn die Natur liefert uns alles: hilfreiche Arzneien und nutzlose Placebos, betäubende Drogen und todbringende Gifte. Und oft genug ist die Frage von Tod oder Heilung eine Frage des Anwendungsbereichs oder eine Frage der Dosis. Noch heute besteht die verbreitete Fehleinschätzung, ein pflanzliches Heilmittel sei a priori unschädlich.
Es ist auch ganz einleuchtend, dass es in der Geschichte der Pflanzenheilkunde eine Fülle von Irrtümern gab. Heute kann man jedoch davon ausgehen, dass, was sich bewahrt hat, sich auch bewährt hat. Ein deutscher Apotheker empfahl einmal, sich bei der Bewertung von Pflanzenheilmitteln an eine Abraham Lincoln zugeschriebene Regel zu halten. Der amerikanische Präsident meinte, man könne eine kleine Zahl von Leuten eine lange Zeit und eine grosse Zahl von Leuten eine kurze Zeit täuschen. Es sei aber unmöglich, eine grosse Zahl von Menschen eine lange Zeit zu täuschen. Auf die Phytotherapie übertragen würde das bedeuten, dass eine Pflanze, die lange Zeit von zahllosen Patienten eingesetzt wurde, ihre Wirksamkeit nicht mehr beweisen muss.
In der Antike bestand die «ärztliche» Tätigkeit hauptsächlich in der Anwendung von Pflanzen als Arznei. Die Vorläufer der modernen Medizin sind deshalb zugleich die Väter der modernen Phytotherapie: von Hippokrates (400 v. Chr.) über Dioskurides (50 n. Chr.), Plinius d. Ä. (70 n. Chr.), Galen (2. Jh.) über Albertus Magnus (13. Jh.) bis Paracelsus (16. Jh.).

Im Zuge der griechischen Naturphilosophie entwickelte sich die Lehre von den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft und daraus, auf den Menschen bezogen, die Viersäftelehre, die bis weit in die Neuzeit hinein die abendländische Medizin bestimmte. In diesem Gedankengebäude wurden auch die Pflanzen in Beziehung zu den vier Körpersäften – schwarze Galle, gelbe Galle, Blut und Schleim – gesetzt. Im Gegensatz zu dieser medizinischen Theorie stand die christliche Auffassung, dass Gott in dem von ihm geschaffenen Kosmos für jede Krankheit ein Heilmittel zur Verfügung stellt. Mit der Vorstellung einer gottgegebenen Pflanzenheilkunde entwickelte sich die sogenannte Signaturenlehre, an der vor allem Paracelsus grossen Anteil hatte. Aus Geschmack, Form, Farbe und anderen Besonderheiten der Pflanzen wurde auf die heilende Wirkung geschlossen, das heisst, der Kräuterkundige hatte die vom Schöpfer vorgegebenen Zeichen zu entschlüsseln. Das führte beispielsweise dazu, dass der gelbe Milchsaft des Schöllkrauts (Chelidonium majus L.) als Galle- und Lebermittel, die den männlichen Hoden ähnlichen Wurzelknollen der Orchideen als Aphrodisiakum und die Walnuss wegen ihrer dem Gehirn gleichenden Oberfläche als Medizin bei Geisteskrankheiten galt.
Von der Barockzeit an wurde versucht, die Zusammensetzung der Pflanzen zu erforschen. Die zu diesem Zweck durchgeführten Experimente bestanden aber hauptsächlich darin, die Pflanzen zu verbrennen, und blieben deshalb weitgehend erfolglos.
Nach dem Untergang des römischen Reiches verlagerte sich die pflanzenmedizinische Tradition auf die Klöster. Dort wurden nicht nur die Schriften berühmter Heilkundiger aus früherer Zeit kopiert, sondern auch vielerorts Kräuter- und Heilpflanzengärten gehegt und gepflegt und dadurch neues medizinisch-botanisches Wissen erworben. So verfasste beispielsweise Walahfrid Strabo, der Abt von Reichenau, im 9. Jahrhundert Lehrgedichte über Heilpflanzen, und die Äbtissin Hildegard von Bingen (1098–1179) erwarb sich mit ihren beiden lateinisch geschriebenen Büchern grosse Verdienste um die Verbreitung der Heilpflanzenkunde.
Zu gleichen Teilen Knoblauch, Zwiebeln, Wein und Ochsengalle: Daraus bestand eine im 1000 Jahre alten Rezeptbuch «Bald's Leechbook» beschriebene Augensalbe. Forscher der University of Warwick konnten in einem Experiment zeigen, dass die Augensalbe tatsächlich krankmachende Bakterien wie Staphylococcus aureus abtötet oder zumindest stark reduziert – und sie wirkt sogar gegen multiresistente mikrobielle Biofilme. Neu für die Forscher war, dass die Wirkung auf bereits bekannten, einzeln indes wenig effektiven Inhaltsstoffen beruhte. Knoblauch ist zwar schon länger für seine antimikrobiellen Eigenschaften bekannt – gegen die Bakterien konnte das Gewächs allein aber nicht viel ausrichten. Erst die Kombination mit den anderen Zutaten führte zum Abtöten der Keime. Da sich die Medikamentenforschung zumeist nur auf einzelne Stoffe konzentriert, könnten so wirksame Verbindungen übersehen werden, schreiben die Wissenschaftler.
Ab dem 15. Jahrhundert begann die Blütezeit der Kräuterbücher, die in immer genaueren Zeichnungen und Schilderungen «medizinisch-pharmazeutische Gewächse» darstellten. Berühmt sind die illustrierten Kräuterbücher der Botaniker Otto Brunfels, Hieronymus Bock, Leonhard Fuchs und Theodorus Tabernaemontanus (alle 16. Jh.), die allesamt auch Ärzte waren. Im angelsächsischen Raum spielten die botanischen Werke von u.a. William Turner (16. Jh.), John Ray (17. Jh.) und Nicolas Culpeper (18. Jh.) eine wichtige Rolle. Auch die flämischen Botaniker und Ärzte Rembert Dodoens, Matthias de L’Obel und Charles de L’Ecluse (Carolus Clusius) schrieben im 16. Jahrhundert bedeutende Werke. Alle drei arbeiteten in vielen Ländern Europas; L’Ecluse verfasste Werke über die Flora Spaniens, Österreichs, Portugals und Ungarns.
Im Laufe dieser Zeit gab es zahlreiche Versuche, eine systematische Einteilung der Pflanzen zu erarbeiten. Doch erst dem schwedischen Arzt und Naturforscher Carl von Linné gelang es 1735, das Chaos in den Pflanzenbezeichnungen zu beenden und Grundlagen für eine botanische Nomenklatur einzuführen. (Internationale Regeln für die Artbeschreibung und Nomenklatur wurden erst Ende des 19. Jahrhunderts eingeführt. Heute können genetische Untersuchungen zusätzliche Erkenntnisse für die Artenbestimmung liefern.)
Manche Ärzte und Pflanzenforscher meinen, nichts habe der Anerkennung der Phytotherapie so sehr geschadet wie die Wiederholung oder sogar die Übernahme phantasievoller und abstruser Indikationen aus der Zeit der mittelalterlichen Kräuterheilkunde.
Prof. Dr. med. Rudolf Fritz Weiss (1895–1991), Begründer der wissenschaftlichen Pflanzenheilkunde, Herausgeber der renommierten «Zeitschrift für Phytotherapie» und Verfasser des Standardwerks «Lehrbuch der Phytotherapie», das auch auf englisch, dänisch und japanisch erschien, forderte deshalb schon vor mehr als sechzig Jahren: «Es gilt zu beweisen, dass die Pflanzenheilkunde an wissenschaftlicher Gründlichkeit und praktischer Brauchbarkeit in nichts hinter anderen Teilgebieten der Medizin zurücksteht.»
Begonnen hatte alles mit dem Aufschwung der organischen Chemie. Auf den ersten isolierten Wirkstoff (1805: Morphium aus Opium) folgten Schlag auf Schlag viele weitere Substanzen, die man als Phytopharmaka bezeichnete. Strychnin aus Brechnuss (Strychnos nux vomica) 1819, Coffein aus der Kaffeebohne (Coffea) 1819, Chinin aus Chinarinde (Cinchona pubescens) 1820, Codein aus Opium 1832, Digitoxin aus dem Roten Fingerhut (Digitalis purpurea), Strophantin aus dem Samen des afrikanischen Schlingstrauchs Strophanthus gratus oder Atropin aus der Tollkirsche (Belladonna atropa) waren frühe, wichtige Meilensteine in der Entdeckung und Isolierung pflanzlicher Inhaltsstoffe, die auch dem medizinischen Laien ein Begriff sind.

Roter Fingerhut: Geringe Spanne zwischen heilender und schädigender Dosis (Foto: W. Jost)
Nach und nach konnten viele Inhaltsstoffe isoliert, ihre Struktur aufgeklärt – und die empirische Wirkung wissenschaftlich belegt werden. Nachdem die chemische Struktur der Naturstoffe gefunden war, folgte bald die synthetische Herstellung im Labor – in vielen Fällen wird die Pflanze gar nicht mehr benötigt. An die Stelle der Behandlung mit dem gesamten Wirkstoffspektrum der Pflanze oder des Pflanzenteils trat nun die Therapie mit sogenannten Monopräparaten, die nur einen pharmakologisch wirksamen Bestandteil enthalten.
Allerdings traten mit dem Aufkommen der chemisch-synthetischen Heilstoffe die traditionellen Heilpflanzen in den Hintergrund, und man konnte mit ihnen nicht mehr viel anfangen. Man bevorzugte die genaue chemische Definition, die sofort und deutlich im Experiment messbare Wirkung und war begeistert, die Ergebnisse jederzeit reproduzieren zu können.
So einseitig dieser Weg war, letztlich hat er der gesamten Phytotherapie erheblichen Aufschwung gebracht, denn sie wurde auf diesem Weg wieder Gegenstand wissenschaftlicher Forschung.
Die Methode, wirksame Inhaltsstoffe in reiner kristalliner Form zu isolieren, eignet sich jedoch ganz überwiegend nur für die stark oder forte wirksamen Heilpflanzen, bei denen ein oder sehr wenige Inhaltsstoffe die Wirkung ausmachen.
Forte-Pflanzenheilmittel haben Nebenwirkungen, manche sind äusserst giftig. Deshalb ist es sicher sinnvoller, bestimmte Herzrhythmusstörungen mit isolierten, genau dosierbaren Digitalispräparaten zu behandeln statt mit einem Tee aus rotem Fingerhut. Die Gratwanderung zwischen heilender und giftiger Dosis wäre viel zu riskant.
Der Nachteil dieser Verfahrensweise liegt darin, dass bei vielen altbewährten Heilpflanzen, bei denen kein einzelner signifikanter Inhaltsstoff isoliert werden konnte, die Wirksamkeit infrage gestellt wurde. Dieser Geringschätzung fielen vor allem die zahlreichen, schwach oder mite wirkenden Pflanzen mit ihren sehr komplexen Inhaltsstoffen zum Opfer.
Bei den meisten schwach oder mild wirkenden Heilpflanzen fehlt eine Reinsubstanz, welche allein oder hauptsächlich die Wirkung bestimmt. Gerade die Mite-Pflanzenheilmittel sind aber ein Beispiel dafür, dass es sich in sehr vielen Fällen um ein ganzes Ensemble von Wirkstoffen handelt, bei dem die einzelnen Komponenten ineinandergreifen und den heilenden Effekt erst in ihrer Gesamtheit hervorbringen. Dabei wäre es völlig falsch, schwach wirkend mit unwirksam gleichzusetzen – vielmehr bedeutet es, dass von der Heilpflanze keine unmittelbar intensive Wirkung zu erwarten ist (wie bei einer Digitalisspritze) und sie auch über längere Zeit ohne Schaden eingenommen werden kann.

Pflanzenheilmittel (hier: Sägepalme): Im Vergleich zu synthetischen Präparaten häufig geringere Nebenwirkungen
Ob Herzschwäche oder Hauterkrankung, Nieren- und Blasenleiden, Rheuma und andere Gelenkerkrankungen, Wechseljahrsbeschwerden, Stoffwechselerkrankungen, Schmerzen, Depressionen, Durchblutungsstörungen, Erkältungen, gutartige Prostatavergrösserungen, Magen-/Darmleiden, Schlafproblemen oder Nervosität – gegen zahlreiche Leiden, chronische oder akute, ist ein Kraut gewachsen.
Obwohl Phytopharmaka (HMPs, Herbal Medicinal Products, wie man in der internationalen Fachsprache sagt) in der ärztlichen Versorgung der Patienten (noch) eine untergeordnete Rolle spielen, macht sich in den letzten Jahren überall auf der Welt ein Umdenken breit: Es wird anerkannt, dass die Phytotherapie ihre Stärken hat und sich synthetische Medikamente und Heilpflanzenpräparate ergänzen können und müssen.
Übrigens tragen keineswegs allein die Ärzte die Verantwortung dafür, dass schnell und stark wirkende Präparate (mit den unvermeidlichen Nebenwirkungen und Resistenzen) bevorzugt werden, denn auch die Patienten drängen oftmals auf prompte Reparaturen und schnelle Lösungen, ohne nach den Nebenwirkungen zu fragen oder gar nach den Ursachen der Erkrankung zu forschen.
Ein reiner Wirkstoff besteht aus einer einzigen Substanz (einem chemischen Molekül), die sich durch physikalische Methoden nicht weiter reinigen lässt. Solche Wirkstoffe haben genau bekannte physikalische oder pharmakologische Wirkungen (und Nebenwirkungen).
Eine Pflanze enthält aber Hunderte, ja Tausende von chemischen Verbindungen, die im Zusammenspiel in synergetischer Weise wirken. Viele herkömmliche Testverfahren sind deshalb mit der Komplexität der Pflanzenpräparate überfordert, und es ist ungeheuer schwierig, die lang erprobte Wirksamkeit exakt zu beweisen. So konnte bis heute beispielsweise das «Geheimnis» der beruhigenden Wirkung des Baldrians (Valeriana off.) oder der Passionsblume (Passiflora incarnata) nicht völlig entschlüsselt werden.
Die Isolation und Untersuchung einzelner Wirkstoffe zeigt immer nur einen Teil der Gesamtwirkung, denn alle anderen vorhandenen – und seien sie scheinbar noch so unwichtig – beeinflussen die Art, die Dauer und sogar den Zeitpunkt der Wirkung. «Ausser den besonders wirksamen Inhaltsstoffen haben auch die Nebenwirkstoffe und die Ballaststoffe Anteil an der guten Wirkung und Verträglichkeit von pflanzlichen Arzneien», so Prof. Dr. med. Reinhard Saller, der erste Inhaber eines Lehrstuhls für Naturheilkunde an einer Schweizerischen Universität (Zürich).
«Jede Pflanze stellt etwas Fertiges, in sich Abgeschlossenes dar; denn es handelt sich dabei um ein Rezept, dem Intelligenz, Voraussicht und weise Planung zugrunde liegt. Für den Wert der einzelnen Pflanze entsteht ein Risiko, wenn man ihr zweckmässig überlegtes Gefüge auseinanderreisst.» – Alfred Vogel

Zahlreiche Arzneipflanzen enthalten, wie wir gesehen haben, eine Mischung aus sehr vielen Stoffen. Um die Sache noch komplizierter zu machen: Diese Wirkstoffgemische sind auch bei einer bestimmten Pflanze keineswegs konstant. Die Erfahrung zeigt, dass die Pflanzenqualität, der Boden, das Wetter und der Erntezeitpunkt auf die Inhaltsstoffe Einfluss nehmen. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen: Selbst eine einzelne Pflanze kann ein etwas anderes Spektrum an Inhaltsstoffen aufweisen als die benachbarte Pflanze, die auf dem gleichen Feld unter den gleichen Bedingungen heranwächst.
Wie unter diesen Voraussetzungen qualitativ hochstehende, gleichbleibend wirksame und sichere Heilmittel entstehen, die den Anforderungen des Verbrauchers gerecht werden, und welche Rolle dabei die «Philosophie» von Alfred Vogel spielt, werden wir in den weiteren Folgen dieser Serie erläutern.

Stachelmohn so effektiv wie gängige Malaria-Medikamente? (Foto: Erwin Meier)
Das renommierte britische Zentrum für botanische Forschung, Kew Gardens, schätzte vor einigen Jahren, dass weltweit insgesamt über 28'000 Pflanzenarten mit medizinischem Nutzen bekannt sind. Insgesamt werden nur rund 16 Prozent der Heilpflanzen auch in anerkannten medizinischen Publikationen erwähnt. Mittlerweile geht man von mehr als 32 000 Pflanzenarten aus, die in therapeutischer und präventiver Absicht verwendet werden. Das Potenzial ist nach wie vor gross, wie das Beispiel Malaria zeigt. Merlin Willcox von der University of Oxford liess sich von Dorfbewohnern in Mali die traditionell verwendeten Pflanzen (66 sind bekannt) gegen die tödliche Infektionskrankheit zeigen. In klinischen Studien testete er diese auf ihre Wirkung und kommt zu dem Schluss, dass sich ein Getränk aus dem Mexikanischen Stachelmohn (Argemone mexicana, im Bild) als fast genauso effektiv erweist wie bekannte Malaria-Medikamente. Und: Die Entwicklung dieses Arzneimittels kostete nur ein Bruchteil im Vergleich zu einem konventionellen.

Ysopblättriges Gliedkraut, Sideritis hyssopifolia (Foto: Wikimedia Commons/Krzysztof Ziarnek, Kenraiz)
Auch Wissenschaftler vom Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum Frankfurt haben im Fachblatt «The Lancet Planetary Health» zu grösseren Forschungsanstrengungen an Heilpflanzen aufgefordert. Heilpflanzen und ihre bioaktiven Stoffe böten enorme Möglichkeiten für die zukünftige medizinische Versorgung der Menschheit. Doch von den etwa 374 000 bekannten Pflanzenarten sind bislang nur 15 Prozent chemisch und gerade einmal sechs Prozent unter pharmakologischen Gesichtspunkten analysiert. Dabei basiere jedes zweite neue Medikament der letzten 40 Jahre auf pflanzlichen Inhaltsstoffen.
Die Forscher weisen auch auf die Gefahren durch den Klimawandel und den Menschen hin. Denn die Pflanzenstoffe können nur wirksam sein, wenn die ökologischen Bedingungen stimmen. Aber auch das übermässige Sammeln durch den Menschen sorgt dafür, dass manche Pflanzen kurz vor dem Aussterben stehen, wie die als griechischer Bergtee genutzten Sideritis-Arten zeigen.
Mehr Pflanzen dank künstlicher Intelligenz
Zwei wichtige Medikamente gegen Malaria, Chinin und Artemisinin, wurden aus Pflanzen gewonnen. Auf der Suche nach neuen Pflanzenarten gegen die Tropenkrankheit zeigt eine Studie des Royal Botanic Gardens in London und der Universität Freiburg in der Schweiz, wie sich künstliche Intelligenz in der Medizin einsetzen lässt. Den Forschenden zufolge gibt es schätzungsweise 343 000 verschiedene Arten von Gefässpflanzen, was die Identifizierung von Wirkstoffen gegen Malaria zeitaufwendig und kostspielig macht. Von den in der Studie 21 000 untersuchten Arten wurden dank KI 7677 gefunden, die genauer untersucht werden sollten. Knapp jede Sechste davon wäre laut der Studie mit konventionellen Methoden übersehen worden.



