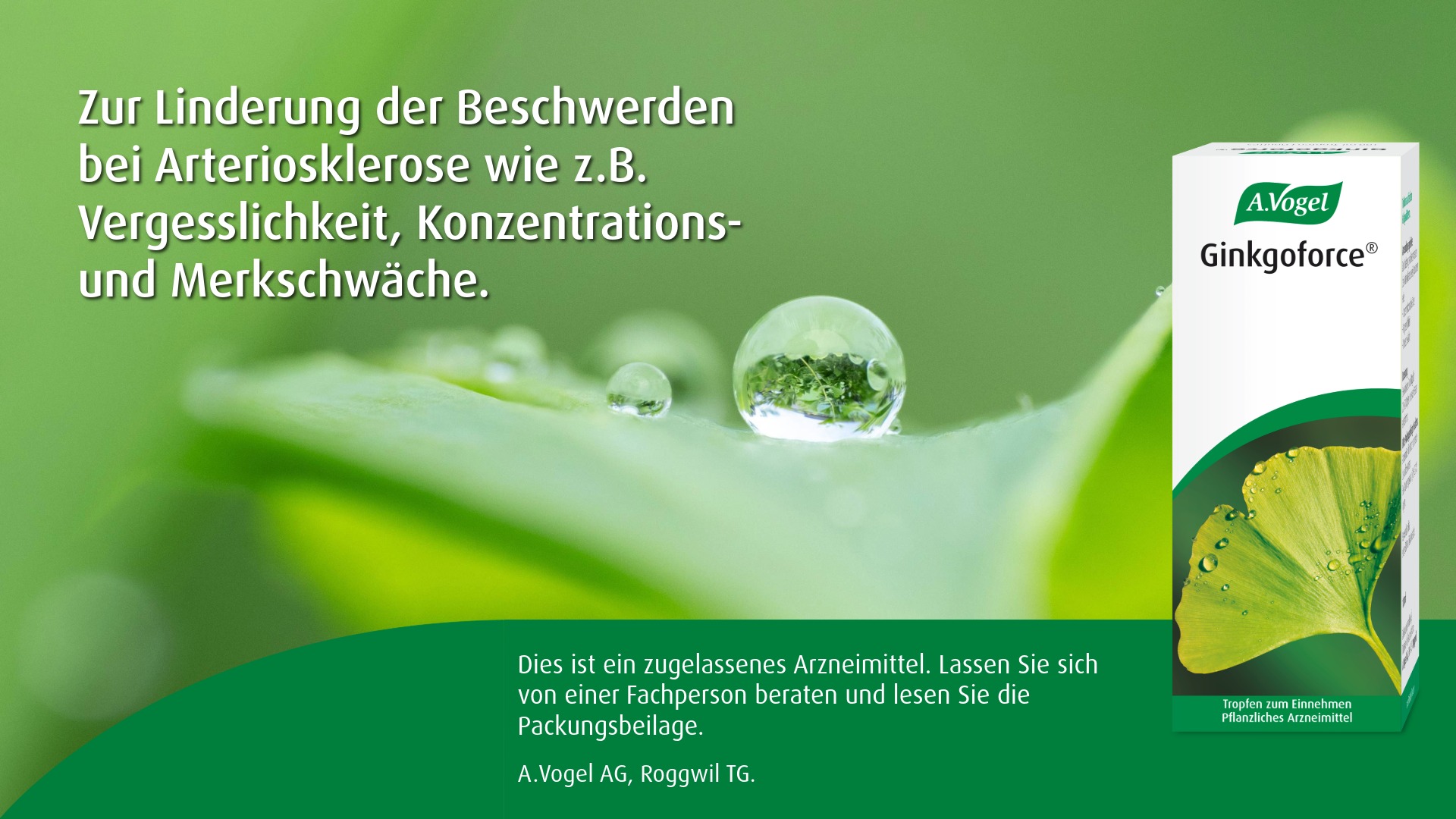A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.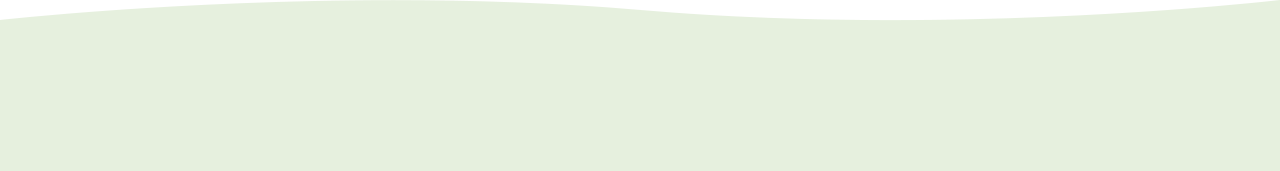
Neuroplastizität: Das lernfreudige Gehirn
Geistige Fitness ist nicht zwangsläufig eine Frage des Alters. Neue Erkenntnisse zur lebenslangen Neuroplastizität.
Text: Gisela Dürselen
Das menschliche Gehirn steuert alle Vorgänge im Körper, und es prägt Emotionen, Moral und Persönlichkeit. Dazu braucht es mindestens 80 Milliarden Neuronen, von denen wiederum jedes über circa 10 000 Synapsen genannte Verbindungen mit anderen Neuronen vernetzt ist. Rund 17 bis 18 Milliarden solcher Nervenzellen sitzen im sogenannten zerebralen Kortex der Grosshirnrinde, der entwicklungsgeschichtlich jüngsten und am höchsten entwickelten Region des Gehirns, die unter anderem für komplexes Denken zuständig ist. Kein Tier besitzt in diesem wichtigen Teil des Gehirns eine vergleichbare Anzahl von Neuronen.
Um seine Aufgaben zu meistern, verbraucht das Gehirn bis zu einem Viertel der täglich aufgenommenen Energie, sagt der Neurowissenschaftler und Psychologe Prof. Lutz Jäncke vom Psychologischen Institut der Universität Zürich. Dies geschehe auch in Ruhe, denn im Hintergrund arbeite das Gehirn immer. Es verarbeite und interpretiere die gemachten Erfahrungen und erstelle so im Unterbewussten ein Modell von der Welt. «Wie wir die Welt betrachten und einschätzen, hängt also wesentlich vom biografischen und damit auch kulturellen Hintergrund ab», so Prof. Jäncke. Dies sei auch einer der Gründe, warum es im Kontakt zwischen verschiedenen Kulturen so oft zu Missverständnissen komme.
Die schlechte Nachricht ist: Der natürliche Alterungsprozess macht auch vor dem Gehirn nicht halt. Etwa ab dem 65. Lebensjahr beginnen die Abbauprozesse. Neuronen und auch das physische Volumen des Gehirns nehmen ab, Hirnregionen arbeiten nicht mehr so effektiv zusammen wie in der Jugend. Besonders stark vom Abbau betroffen ist Prof. Jäncke zufolge der Hippocampus und damit jener Teil des Gehirns, der für Erinnern und Lernen zuständig ist.

Hält das Gehirn jung: Hobbys wie Schach spielen oder sportliche Aktivitäten im Freien, z.B. Paddeln.
Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Der Abbau geschieht langsam, mit rund 0,5 Prozent des Volumens jährlich – und er ist individuell sehr unterschiedlich. Im Rahmen des Projektschwerpunktes «Dynamik des gesunden Alterns» beobachtete Prof. Jäncke mit seinem Team seit 2011 in einer Langzeitstudie mit Schweizer Senioren, dass sich bei etwa 5 bis 10 Prozent der Teilnehmer der Hippocampus mit der Zeit sogar vergrösserte anstatt wie bei anderen zu schrumpfen. Diese Leute waren in jeder Hinsicht die aktivsten, und sie waren auch am wenigsten anfällig für neurologische Erkrankungen wie Demenz. Wie die Studie ergab, wirken sich körperliche und soziale Aktivitäten insbesondere schützend auf den Kortex aus, der bei der Alzheimer-Erkrankung bereits im frühen Stadium beeinträchtigt ist.
«Der Zustand unseres Gehirns hängt also davon ab, was wir machen», erklärt Prof. Jäncke. Denn Bestand habe im Gehirn nur das, was gebraucht werde: Wiederkehrende Aktivitäten stärkten bestimmte Verbindungen zwischen den Neuronen; nicht genutzte Synapsen würden weniger und verschwänden bei anhaltendem Nichtgebrauch ganz. Da die im Gehirn gespeicherten Informationen von der Stärke der Netzwerkverbindungen abhingen, sei ein zentrales Element beim Lernen und Erinnern die Wiederholung: «Alles, was wir intensiv üben, verändert unser Gehirn.»
Bei der bis heute laufenden US-amerikanischen «Nonnenstudie» zur Demenzforschung sei die intellektuelle Leistungsfähigkeit betagter Nonnen mit den jeweils postmortal erhobenen Untersuchungsergebnissen der Gehirne verglichen worden: Dabei hätten die pathologischen Gehirnbefunde wiederholt typische Anzeichen von Alzheimer ergeben. Gleichzeitig seien diese Teilnehmerinnen aber zu Lebzeiten geistig topfit gewesen. «Warum kann man eine Degeneration im Gehirn messen, wenn keine geistigen Defizite zu erkennen sind?» gibt Prof. Jäncke zu bedenken.
Die entscheidende Frage laute: «Was macht der Rest des Gehirns, was machen die Neuronen, die nicht gestorben sind?» Der logische Schluss sei: «Eine anatomische Degeneration ist kein zwingender Indikator für abnehmende kognitive Fähigkeiten. Andere, intakte Hirngebiete können effizienter arbeiten und somit die anatomischen Defekte kompensieren. Wer ein Leben lang ein aktives, auch geistig aktives Leben gelebt hat, verfügt über eine kognitive und oft auch anatomische Reserve, welche in der Lage ist, Abbauprozesse im Alter auszugleichen.»

Ob ein Mensch bis ins hohe Alter geistig vital bleibt, hängt also gar nicht so sehr von der noch vorhandenen Gehirnsubstanz ab, sondern vielmehr von seiner Funktionsfähigkeit – und diese kann selbst nach schwerwiegendsten Schädigungen, etwa durch Schlaganfall oder Schädel-Hirn-Trauma infolge Unfalls zumindest teilweise wiederhergestellt werden. Mehreren Studien zufolge ist das Gehirn auch in solchen Fällen in der Lage, neue Verbindungen herzustellen und sich wieder neu zu strukturieren, um vorhandene Störungen auszugleichen.
Um mit einem gesunden Gehirn alt zu werden, empfiehlt Prof. Jäncke fünf zentrale Massnahmen: «körperliche, geistige und soziale Fitness, dazu die Vermeidung von Diabetes und Bluthochdruck.»
Ein Musikinstrument oder eine Sprache für sein Lieblingsurlaubsland erlernen, tanzen oder eine neue Sportart einüben, seien dabei sinnvoller in den Alltag zu integrieren als etwa beim Gehirnjogging Zahlenreihen auswendig zu lernen oder Rechenaufgaben zu lösen. Tanz im sozialen Kontext fordere beispielsweise das Gehirn multidimensional, durch die Bewegung verbesserten sich zudem Sauerstoffzufuhr und Durchblutung.
Eine optimale Versorgung mit Sauerstoff und Blut ist wichtig, damit das Gehirn seine Aufgaben erfüllen kann. Die vaskuläre Demenz etwa, verursacht durch eine Durchblutungsstörung des Gehirns und nach Alzheimer die zweithäufigste Form von Demenz, kann unter anderem durch Übergewicht, Bluthochdruck und Diabetes ausgelöst werden. Sowohl Bluthochdruck als auch Diabetes beeinflussen negativ den Stoffwechsel, was zu einer Verengung der Blutgefässe und wie bei Alzheimer zu Ablagerungen im Gehirn führen kann. Erhöhter Blutzucker und Blutdruck wiederum werden laut einer Reihe von Studien begünstigt durch chronischen Stress.
Im Kern komme es darauf an, nicht erst im Alter, sondern beizeiten Körper und Geist sowie die Lust und Freude am Leben mit einem gewissen Mass an Stimulus-Kontrolle zu verbinden, betont Prof. Jäncke. Dies gelte auch für gewisse Ernährungsempfehlungen zur Gehirn-Fitness. Wer einen disziplinierten Lebensstil pflege, bewege sich sowieso ausreichend und vermeide Übergewicht; er halte sich gesund durch abwechslungsreiche Ernährung und könne dabei ganz ohne Diät und Askese geniessen. Ein solcher Mensch döse auch nicht jeden Abend auf der Couch vor dem Fernseher und langweile damit sein Gehirn – oder surfe den ganzen Tag in sozialen Netzwerken und überfordere es durch viel zu viele, grösstenteils unsinnige Reize.
Eine Sprache lernen, die Spass macht, ist auch in höherem Alter noch möglich – allerdings nicht so mühelos wie in der frühen Kindheit. Denn im Laufe eines Lebens gibt es sogenannte sensitive Phasen und damit Zeitfenster für eine erhöhte Neuroplastizität, in denen bestimmte Dinge besonders leicht gelernt werden können. Nie mehr im späteren Leben ist z. B. die Neuroplastizität des Gehirns so ausgeprägt wie in der frühen Kindheit. So verfügen Neugeborene bei ihrer Geburt über viel mehr neuronale Verbindungen als sie wirklich benötigen. Was gebraucht wird, verstärkt sich im Laufe der Entwicklung – der Rest verschwindet.

Ganz entspannt an früher denken, auch wenn sich dabei Erinnerungslücken auftun? Kein Problem: Im Langzeitgedächtnis ist das Vergessen genauso wichtig wie das Behalten, sagen Forscher.
Dass sich Netzwerke wieder zurückbilden, Neuronen verloren gehen und Inhalte gelöscht werden, ist somit nicht nur ein Phänomen des Alterns, sondern kommt in jeder Lebensphase vor – und ist oft auch wichtig. Denn die Entwicklungsgeschichte hat das Gehirn im Sinne einer Überlebensstrategie so eingerichtet, dass es mit seiner Struktur und seinen Funktionen optimal an die jeweils aktuelle Lebenssituation angepasst ist und bestmöglich reagieren kann. Dazu gehört auch das Löschen von Ballast.
Eine 2023 in «Molecular Psychiatry» veröffentlichte US-amerikanische Übersichtsarbeit betont, dass Schrumpfung nicht grundsätzlich als Beeinträchtigung zu sehen ist. Im Guten wie im Schlechten seien «abwärts» gerichtete Veränderungen im Gehirn, also die Schwächung respektive das Verschwinden bestimmter Synapsen, ein Teil des Neuroplastizitätsprogramms und nicht dessen Mangel. Die Neuroplastizität des Gehirns sei damit konzeptionell als ein Gleichgewicht zu verstehen zwischen beiden Richtungen, mit denen sich das Gehirn erst flexibel an bestimmte Anforderungen anpassen könne. Beide Teile ergänzten sich gegenseitig und befähigten das Gehirn, seine Verbindungen durch neuronale Feinabstimmung so umzugestalten, dass die Effizienz des Netzwerks für bestimmte Bedingungen optimiert werde.
Im Langzeitgedächtnis hält Prof. Jäncke das Vergessen sogar fast für noch wichtiger als das Behalten, weil dann nur Relevantes Bestand habe. Essenziell sei Vergessen vor allem bei «eingefrästen negativen Gedächtnisinformationen», etwa bei diversen Angststörungen und posttraumatischen Belastungsstörungen, aber auch bei schlechten Gewohnheiten, die nicht einfach so verschwinden, sondern aktiv durch bestimmte Strategien oder eine Therapie verlernt werden müssen. Denn solche Muster seien oft mit starken Emotionen verbunden oder – wie im Falle von schlechten Gewohnheiten – mit vielen Wiederholungen fest in der Gehirnstruktur verknüpft und stünden daher in der Hierarchie des Informations-Netzwerks ganz oben.
Der umfassende Gesundheits-Newsletter von A.Vogel erscheint 1 x pro Monat und enthält Informationen, Tipps, Wettbewerbe und vieles mehr – rund um alle Gesundheitsthemen.
2023 endete das «Human Brain Project», eine internationale Kooperation, die sich einem tieferen Verständnis des menschlichen Gehirns widmete. Das Projekt lief über zehn Jahre und hatte zum Ziel, das Gehirn mit all seinen Milliarden Neuronen und Billionen von Synapsen in einer Computersimulation darzustellen. Die Studie lieferte viele wichtige Erkenntnisse, etwa über kognitive Funktionen und die Anatomie des Gehirns – aber das eigentliche Ziel, die Simulation, wurde nicht erreicht: Noch immer sei die ganze Komplexität des Gehirns nicht gänzlich verstanden, sagt Prof. Jäncke. Beispielsweise wisse man nicht, wie Neuronen Bewusstsein generieren können.
In einem Nachfolgeprojekt, so vermutet Prof. Jäncke, werde man andere Wege gehen: Nun sei die Künstliche Intelligenz (KI) der Taktgeber der Forschung; darum werde man versuchen, technische Systeme zu entwickeln, die möglichst genauso funktionieren wie ein menschliches Gehirn. Beide besitzen grundlegend andere kognitive Eigenschaften und Fähigkeiten, und beide haben Stärken und Schwächen.
KI-Systeme können besser Dinge wie Datenanalyse, Auswendiglernen und Statistik – dafür sorgen Störungen beim Lernen dafür, dass bereits vorhandenes Wissen gelöscht wird. Menschliche Gehirne sind kreativer und experimentierfreudiger, und sie verbrauchen vor allem ein Vielfaches weniger an Energie
als die KI. Würden KI-Systeme ähnlicher den menschlichen Gehirnen arbeiten, wären sie wesentlich energieeffizienter.
ANZEIGE: