A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.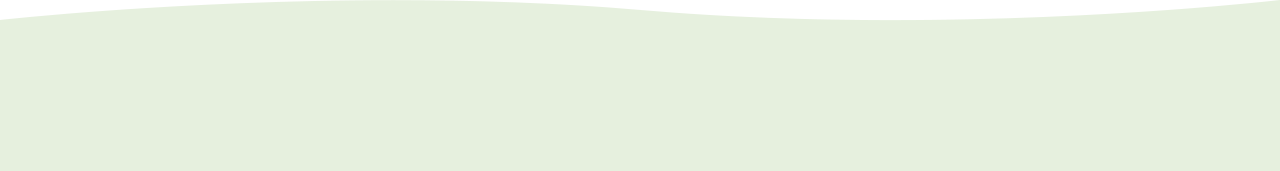
Stress lass nach!
Die STRESS-Studie
Immer mehr Menschen kommen nicht mehr zur Ruhe. Das hat Folgen für die Gesundheit.
Interview: Andrea Pauli
- Den Studierenden in der Schweiz geht es im Vergleich zu Studierenden in anderen Ländern relativ gut
- Soziale Unterstützung ist ein wichtiger Faktor für Resilienz auch hängt auch mit immunologischen Markern zusammen
- Früh erlebter Stress und Traumatisierung können zu langfristigen Einschränkungen der kardiovaskulären Funktion im Erwachsenenalter führen
- ein breites Repertoire an Bewältigungsstrategien stärkt die Resilienz
Wir führen ein Leben, in dem unsere Stresssysteme ständig aktiv sind. Forschende sehen in dieser Entwicklung ein massives Problem für die öffentliche Gesundheit. Um das anzugehen und neue therapeutische Ansätze zu entwickeln, haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den Bereichen Psychiatrie und Psychologie, der Neurowissenschaften, Zell- und Molekularbiologie, Kardiologie, Ingenieurwissenschaften und der translationalen Bioinformatik in Zürich das Projekt STRESS ins Leben gerufen. Ziel ist, das Risiko und die Widerstandsfähigkeit von Stressbelastungen über die gesamte Lebensspanne hindurch sowie deren Auswirkungen auf die Gesundheit zu untersuchen.
Prof. Birgit Kleim und Ihre Kolleginnen und Kollegen geben Einblick in ihre Arbeit.
B.K.: Gemeinsam mit über 15 Partnerinstitutionen haben wir Stress aus ganz unterschiedlichen Perspektiven untersucht – vom Tiermodell bis zum Menschen, von biologischen Mechanismen im Labor bis hin zu alltagsnahen Stressprozessen. Für unseren Teil des Projekts kann ich vor allem über die Auswertungen aus einer grossen Studie mit Medizinstudierenden im ersten Praktikum – für die meisten ein massiver Stressfaktor – berichten, die wir zusammen mit Laura Meine und Ella McPherson über mehrere Jahre begleitet haben.
Ein zentrales Ergebnis ist, dass es den Studierenden in der Schweiz – im internationalen Vergleich – insgesamt relativ gut geht. Besonders auffällig waren die im Durchschnitt überraschend stabilen Schlafmuster. Das hat auch internationale Kolleg:innen, die uns im Rahmen des Projekts besucht haben, erstaunt, da Medizinstudierende im Praktikum in vielen anderen Ländern deutlich stärkere Schlafprobleme berichten.
Darüber hinaus konnten wir bestätigen, dass soziale Unterstützung ein zentraler Prädiktor für Resilienz ist. Neu ist jedoch, dass wir zeigen konnten, dass soziale Unterstützung auch mit immunologischen Markern zusammenhängt. Das legt nahe, dass soziale Ressourcen nicht nur subjektiv als hilfreich erlebt werden, sondern tatsächlich bis auf die Ebene biologischer Stresssysteme wirken. So beginnen wir zu verstehen, über welche Mechanismen soziale Faktoren „unter die Haut gehen“ und Resilienz fördern können.
B.K.: Ja, durchaus. Besonders überrascht hat uns zum einen, wie gut sich zentrale Stress- und Erregungssysteme des Gehirns mit sehr einfachen, nicht-invasiven Methoden erfassen lassen. In einer aufwendigen Studienanordnung konnten wir zeigen, dass die flexible Regulation des Hirn-Erregungssystems eng mit Resilienz zusammenhängt. Diese Regulation lässt sich erstaunlich präzise über die Pupillenerweiterung messen – ein Signal, das sehr sensibel auf Stress und Anpassungsprozesse reagiert.
Unsere Kolleg:innen um Nici Wenderoth und Sarah Meissner konnten diese Erkenntnisse weiterführen und mit innovativen, Virtual Reality-basierten Ansätzen kombinieren. Dabei lernen Teilnehmende, ihr eigenes Pupillensignal gezielt zu regulieren. Das eröffnet spannende Perspektiven für Trainings- und Interventionsansätze in ganz unterschiedlichen Settings – von Prävention bis hin zu klinischen Anwendungen.
Überraschend und zugleich sehr eindrücklich waren auch die Befunde aus dem Tiermodell von Francesco Paneni und Isabelle Mansuy: Früh erlebter Stress und Traumatisierung bei jungen Mäusen führten zu klaren, langfristigen Einschränkungen der kardiovaskulären Funktion im Erwachsenenalter. Diese Effekte wurden in dieser Form bislang kaum gezeigt und liefern wichtige mechanistische Hinweise darauf, wie frühzeitiger Stress langfristige körperliche Gesundheit beeinflussen kann – mit klaren Implikationen auch für den Menschen.
Und die Forschung bei Eltern und Kindern von den Kolleg:innen Nora Raschle, Todd Hare und Mirjam Habegger zeigt, dass sowohl belastende als auch unterstützende elterliche Verhaltensweisen mit der Entwicklung wichtiger Hirnregionen, wie zum Beispiel dem Präfrontalkortex oder limbischen Arealen, zusammenhängen. Diese Hirnregionen sind für Stressverarbeitung, Emotionen und soziales Verhalten bedeutsam. Bei Jugendlichen mit Auffälligkeiten im Sozialverhalten sagt die Aktivität dieser Hirnregionen sogar voraus, wie gut sie von einer Therapie profitieren – viele von ihnen hatten bereits in der frühen Kindheit ein erhöhtes Stresserleben (Habegger et al., 2025; Raschle et al., 2025; weitere projektbezogene Studien 2023-2025).
B.K.: Unsere Daten sprechen sehr klar für einen zentralen Faktor: Flexibilität. Das gilt sowohl auf psychologischer Ebene als auch auf neurobiologischer Ebene, etwa für die flexible Regulation des Hirn-Erregungssystems. Resiliente Personen zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie eine einzelne „richtige“ Strategie nutzen, sondern dadurch, dass sie über ein breites Repertoire an Bewältigungsstrategien verfügen.
Wir untersuchen aktuell, inwieweit sich Menschen darin unterscheiden, wie vielfältig dieses Repertoire ist – und wie flexibel sie Strategien je nach Situation anpassen oder auch wechseln können. Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass es besonders wichtig ist, Strategien nicht starr beizubehalten, sondern sie an unterschiedliche stressige Kontexte anzupassen. Was in einer Situation hilfreich ist, kann in einer anderen weniger effektiv sein.
Diese Erkenntnisse unterstreichen, dass erfolgreiche Stressbewältigung weniger mit „Durchhalten“ oder „Abhärten“ zu tun hat, sondern vielmehr mit der Fähigkeit, flexibel zu reagieren, Unterstützung zu nutzen und eigene Regulationsprozesse aktiv zu gestalten.
Und das ist erst ein Teil der Ergebnisse. Wir sind aktuell noch mitten in der Auswertung der sehr umfangreichen Daten, die wir über vier Jahre hinweg gesammelt haben- darunter auch Blutproben sowohl bei gestressten Tieren als auch in unserer humanen Stichprobe. Diese Kombination aus Längsschnittdaten, biologischen Markern und alltagsnahen Messungen uns sogar einer Intervention macht das Projekt einzigartig und verspricht noch viele weitere spannende Erkenntnisse.
Stand: 1/2026


