A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.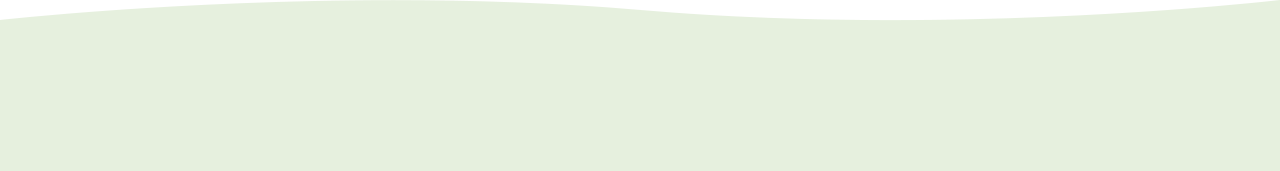
Feinstaub: Probleme für die Atemwege
Wie können Moose helfen?
Feinstaub belastet unser Atemwegssystem und wird für zahlreiche Erkrankungen verantwortlich gemacht. Umweltexperten setzen auf die filternde Wirkung einer ganz besonderen Pflanze.
Autorin: Claudia Rawer, 11/2025
Wo auch immer ein Blitzschlag einen Waldbrand auslöste oder der Mensch ein Feuerchen entzündete, entstand Feinstaub. So bezeichnet man ein komplexes Gemisch aus festen und flüssigen Partikeln, das in primären und sekundären Feinstaub eingeteilt wird. Feinstaub hat es wohl schon immer gegeben. Doch die Industrialisierung, die im 18. Jahrhundert in Grossbritannien entstand, hat die Feinstaubmengen in der Luft massiv erhöht. Erst seit den 1980er-Jahren werden die winzigen Teilchen auch als Problem für die menschliche Gesundheit erkannt.
Der primäre Teil wird unmittelbar an der Quelle freigesetzt, z.B. bei Verbrennungsprozessen. Sekundärer Feinstaub entsteht durch chemische Reaktionen in der Atmosphäre aus gasförmigen Vorläufersubstanzen wie Schwefel- und Stickoxiden.
Abhängig von der Grösse der Teilchen unterscheidet man unterschiedliche Fraktionen: Staubkörnchen, die kleiner als zehn Mikrometer sind, also etwa zehn Tausendstel eines Millimeters klein, bezeichnet man als «PM10» (PM, «particulate matter», ist der englische Ausdruck für Feinstaub). Das sind z.B. Hausstaub, Pollen und Schimmelsporen. Stäube mit einer Korngrösse von nur 2,5 Mikrometern bilden die Fraktion «PM 2,5». Hierzugehören unter anderem eyrxAsbeststaub, Bakterien und besonders Partikel, die bei Verbrennungsprozessen entstehen. Zusätzlich gibt es noch ultrafeine Partikel (UPM) mit einem Durchmesser von weniger als 0,1 Mikrometer. Über diese Kategorie ist vergleichsweise wenig bekannt; Beispiele sind Viren und Russpartikel.
Der PM 10-Anteil kann beim Menschen in die Nasenhöhle, PM 2,5 bis in die Bronchien und tief in die Lunge eindringen. Ultrafeine Partikel erreichen das Lungengewebe und sogar den Blutkreislauf.
Daher ist Feinstaub heute der Luftschadstoff mit den stärksten Auswirkungen auf die Gesundheit. An der Luftverschmutzung sterben jährlich etwa sieben Millionen Menschen.
Wissenschaftler weisen schon seit langem darauf hin, dass die Partikel zu einer Gefahr für Lunge, Herz und Gefässe werden können. «Die Belastung der Luft mit winzigen Staubteilchen ist heute eine der grössten Herausforderungen für die Schweizer Luftreinhalte-Politik», konstatiert das Bundesamt für Umwelt (Bafu). In Agglomerationen und verkehrsreichen Gebieten liegen die Jahresmittelwerte für Feinstaub über dem geltenden Grenzwert; die Tagesgrenzwerte werden häufig und zum Teil massiv überschritten.
Herausragende Staubquelle in städtischen Ballungsgebieten ist der Strassenverkehr. Feinstaub gelangt durch Motoren in die Luft, aber auch durch Bremsen- und Reifenabrieb und durch Aufwirbelung von Staub der Strassenoberfläche. Als stärkste Verschmutzer gelten Dieselmotoren. Das Einatmen von Dieselabgasen ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation gefährlicher als bislang gedacht. Die WHO sieht Belege für einen eindeutigen Zusammenhang mit Krebserkrankungen. Besonders Personen, die über einen längeren Zeitraum den Abgasen ausgesetzt sind, seien gefährdet, z.B. Lastwagenfahrer, Mitarbeiter auf Fährschiffen, Buschauffeure und auch Fussgänger.
Feinstaub ist ein Teil des in der Luft vorkommenden Schwebstaubs, ein Gemisch aus festen und flüssigen Partikeln mit unterschiedlichen Durchmessern. Die Partikel sind mit blossem Auge nicht wahrnehmbar. Während bestimmter Wetterlagen (z.B. bei sogenannter Inversionswetterlage) kann man Feinstaub in Form einer «Dunstglocke» sehen. Erhöhte Feinstaubwerte sind vor allem im Winter vorhanden und treten besonders bei Trockenheit auf. Im Gegensatz zu Regen sorgt Schnee nicht für eine «Auswaschung» des Feinstaubs.
Je kleiner die eingeatmeten Staubteilchen, desto gefährlicher ist ihre Wirkung. Das menschliche Abwehrsystem, das in der Regel über wirksame Mechanismen verfügt, um unerwünschte Fremdstoffe von der Lunge fernzuhalten, «übersieht» offenbar die feinen Partikelchen. Diese Kleinstteile dringen mitunter bis in die Lungenbläschen vor. Dort treten sie in das Gewebe ein, auch in die Zellen und sogar in den Zellkern, welcher die Erbsubstanz enthält. Sie können selbst in die Blutbahn gelangen, wo sich unter Umständen das Fliessverhalten des Blutes verändert. Und mit dem Blut können die feinsten Partikel im ganzen Organismus verteilt werden.
Längerfristig kann das unter anderem zu Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrebs und vorzeitigen Todesfällen führen. Bereits eine kurzfristig erhöhte Partikelbelastung kann Husten, Atemnot, Entzündungen der Atemwege und der Lunge, Bronchitis und Asthmaschübe zur Folge haben. Wissenschaftler gehen zudem Hinweisen nach, dass Metallpartikel aus dem Feinstaub ins menschliche Gehirn vordringen und sich dort anreichern. Dies könnte ein Auslöser von Alzheimer sein respektive das Demenzrisiko steigern. Beweise, dass sich Umweltverschmutzung direkt im menschlichen Gehirn niederschlägt, liegen allerdings bislang nicht vor.
Eine gross angelegte Studie aus Augsburg legte einen Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und Diabetes nahe. Menschen, die bereits einen gestörten Zuckerstoffwechsel hätten, seien besonders empfänglich für die belastenden Effekte der Luftschadstoffe.

Einige Hoffnungen setzen Umweltschützer und Stadtplaner nun in einen natürlichen Feinstaubfänger: Moos! Moose gelten als die ältesten Landpflanzen und sind in vielerlei Hinsicht ein Phänomen. Sie begrünen unwirtlichste Standorte und betreiben selbst im Schatten Photosynthese. Sie sind ein natürliches Insektizid und Fungizid, in Trockenheit wie Kälte wahre Überlebenskünstler – und ein phantastischer Schadstofffilter.
Moose haben weder Wurzeln noch bilden sie Samen oder Blüten. Sie bestehen zum Grossteil aus Blättern, über deren Oberfläche sie Wasser und Nährstoffe aufnehmen. Zur Nährstoffaufnahme bedienen sich die Moose eines Tricks, dem Ionenaustausch. Auf diese Weise, so fand der inzwischen verstorbene Bonner Wissenschaftler Jan-Peter Frahm heraus, werden die bis zur Hälfte im Feinstaub vertretenen anorganischen Salze an der Oberfläche der Moose elektrostatisch gebunden (die Wirkung kann man sich vorstellen wie bei einem Mikrofasertuch), so dem Schwebstaub entzogen und dann verstoffwechselt. Die Oberfläche der Moose ist von Bakterien besiedelt. Diese ernähren sich vom Abbau organischer Stoffe, darunter auch Russ oder Reifenabrieb. Moosmatten, war Frahms Fazit, könnten folglich den Feinstaubgehalt der Luft senken.
Ob dies funktioniert, wird ein Projekt an Deutschlands belastetster Strassenkreuzung zeigen, am Neckartor in Stuttgart. Dort wurde Anfang des Jahres eine 100 Meter lange Wand, bestückt mit dem Grauen Zackenmützenmoos (Racomitrium canescens) und Hornzahnmoos (Ceratodon purpureus), aufgestellt. Ein Jahr lang soll wissenschaftlich untersucht werden, ob Moos tatsächlich nennenswerte Mengen der gefährlichen Feinstaubpartikel aus der Luft filtern kann. In Laborversuchen haben sich die Feinstaub-Bindungskapazitäten bislang als bemerkenswert gut herausgestellt.

Moos- und Flechtenexperten wie der Erlanger Biologe Wolfgang von Brackel bezweifeln jedoch, dass es Moosen gelingt, den Feinstaub gänzlich umzuwandeln. «Alles, was an Schad- oder Nährstoffen auf die Moosoberfläche trifft, nehmen die Pflanzen aufgrund einer fehlenden Aussenhaut ungefiltert auf. Auch die im Feinstaub enthaltenen Schwermetalle nehmen die urtümlichen Pflanzen auf und lagern sie zwischen ihren Zellen ein. Irgendwann ist die Filterleistung erschöpft und die Moose müssen ausgetauscht werden», so von Brackel. Es sei denn, es gelänge, Moosarten zu finden oder zu züchten, die trotz starker Schadstoffeinwirkung dauerhaft am Leben erhalten werden können.
Da sich nicht jeder eine Mooswand vors Haus oder ins Wohnzimmer stellen kann und mag, sollte man zumindest im Alltag mögliche Feinstaubquellen eliminieren: russende Kerzen (die Lungenliga gibt im Internet Tipps zur optimalen Verwendung von Kerzen), Räucherstäbchen und natürlich das Rauchen in geschlossenen Räumen. Wichtig: Regelmässig saugen und glatte Flächen feucht abwischen, anschliessend Fenster öffnen, um sich des aufgewirbelten Feinstaubs zu entledigen. Aufgepasst auch im Büro: Gestautes Papier am Drucker niemals herausreissen, das wirbelt Staub auf. Die schädlichen Stoffe können sich dann auf die Haut legen.

