A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.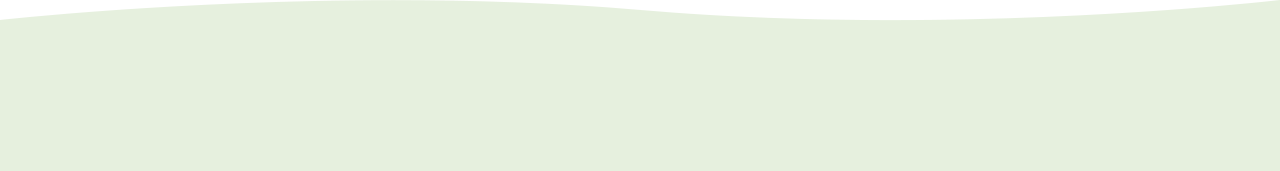
Mistel
Viscum album
Seit mehr als 2000 Jahren erregt die Pflanze wegen ihres Rufs als Glücksbringer und Heilpflanze, ihrer ungewöhnlichen Lebensweise sowie der Verwendung als diskutiertes Arzneimittel das Interesse der Menschen.
Bereits in der Antike wurden Misteln auf Geschwüre gelegt, um sie zu erweichen und zur Reifung zu bringen. Im Mittelalter schrieb Hildegard von Bingen, die zu Pulver verarbeitete Birnbaum-Mistel solle zu gleichen Teilen mit Süssholz vermischt und nüchtern eingenommen werden; dadurch würden Schmerzen im Brustkorb und der Lunge beseitigt. Unbekannt ist, welche Pflanzenteile sie verwendete. Jahrhunderte später wurde für die wilde Apfelbaum-Mistel die Indikation Lungenerkrankungen angegeben. Verstärkt seit dem 15. Jahrhundert – und bis Mitte des 19. Jahrhunderts – wurde ein Pulver aus Mistelstängeln und -blättern als Mittel gegen Epilepsie in zahlreichen europäischen Arzneibüchern (Pharmacopoeia) beschrieben. Ausgehend von der Signaturenlehre nahm man an, dass die Mistel, die nie vom Baum fällt, auch gegen die «Fallsucht» hilfreich sei.
Darüber hinaus fand die Mistel im Laufe der Zeit Anwendung bei Gicht, Herzschwäche, Verdauungs- und Stoffwechselstörungen, Frauen- und Geburtsbeschwerden. Heutzutage werden Extrakte und Tee aus Mistelkraut zur Regulierung des Blutdrucks und zur Unterstützung von Arthrosetherapien verwendet. Zusammen mit Weissdorn wird die Mistel zur Harmonisierung des Herz-Kreislauf-Systems (z.B. Altersherz) eingesetzt.
Vor mehr als 100 Jahren wurde die Misteltherapie in die Behandlung von Krebskranken eingeführt. In der anthroposophischen Arzneimittelkunde werden seither den Patientinnen und Patienten wässrige Extrakte aus der ganzen Pflanze gespritzt. Dabei werden die unterschiedlichen Eigenschaften der Mistel im Jahreslauf (Sommer/Winter) berücksichtigt und in speziellen Verfahren gemischt. Zudem werden besondere Präparate je nach Wirtsbaum hergestellt.
Befürworter der Misteltherapie berufen sich häufig auf eine grosse Zahl vorliegender Studien. Doch die Vielfalt der Produkte, die je nach Hersteller verschiedene Zusammensetzung und die vielfach mangelnde professionelle Qualität der Studien behindern verlässliche Aussagen über die Wirksamkeit der Therapie bei der Heilung von Krebs. Bis heute ist wissenschaftlich nicht nachgewiesen, dass Misteln das Tumorwachstum verlangsamen, eindämmen oder stoppen können. Daher spielt diese Therapie in der wissenschaftlichen Medizin keine Rolle. Das Deutsche Krebsforschungszentrum (dkfz.de) stellt auf seiner Webseite klar: «Alle, auch anthroposophische Ärzte und die Hersteller von Mistelpräparaten in Deutschland, sind sich einig – die Misteltherapie stellt keine Alternative zu geprüften Standardverfahren wie zum Beispiel einer Chemotherapie dar.»
Hingegen galt und gilt die Misteltherapie als eine komplementäre Massnahme, welche die Lebensqualität von Krebspatientinnen und Krebspatienten verbessern kann. Das bedeutet, die Nebenwirkungen einer Krebsbehandlung wie Übelkeit, Fatigue, Diarrhö, Appetit- und Schlaflosigkeit können gemildert werden. Daher wird die Mistel-Injektionstherapie auch immer wieder mal von Betroffenen als begleitende und unterstützende Massnahme erwogen. Die Anwendung sollte nicht ohne Rücksprache mit dem medizinischen Fachpersonal erfolgen.
Da auch in der modernen Medizin Immuntherapien bei onkologischen Erkrankungen immer mehr an Bedeutung gewinnen, verschieben sich die Gewichte. Therapeutisch und ergänzend werden passive und aktive Immuntherapien eingesetzt. In der passiven Therapie werden dem Körper bestimmte Wirkstoffe zugeführt; bei der aktiven Immuntherapie soll die körpereigene Abwehr gestärkt werden. Im Übrigen stehen weitere komplementärmedizinische Behandlungen parallel zur Krebstherapie bzw. im Anschluss daran zur Verfügung; etwa biologische Therapie (Phytotherapie), Mind-Body-Verfahren, Körpertherapien, Akupunktur, Traditionelle Chinesische Medizin (TMC), Homöopathie und andere.
Die Gemeine oder Weissbeerige Mistel aus der Familie der Sandelholzgewächse (Santalaceae) wächst nicht wie andere Pflanzen in der Erde, sondern auf Holz. Im Geäst der kahlen Bäume sind die immergrünen, kugeligen Büschel im Winter gut zu sehen. Botanisch wird Viscum album als Halbschmarotzer bezeichnet. Das bedeutet, dass Misteln, wie (nahezu) alle anderen Pflanzen, mit ihren grünen Blättern die zu ihrem eigenen Wachstum notwendige Energie mithilfe der Photosynthese gewinnen. Allerdings ist die eigenständige Nährstoffversorgung nur die halbe Wahrheit. Für Wasser und die darin gelösten Mineralstoffe aus der Erde brauchen sie den Baum, auf dem sie sich angesiedelt haben.
Für den Transport in die Höhe sorgt ein Saugwurzelsystem, das die Baumrinde durchdringen und die Leitungsbahnen des Wirtsbaumes anzapfen kann. Das alles benötigt Zeit: Vom auskeimenden Samen und dem ersten grünen Blattpaar bis zur ersten Blüte vergehen etwa fünf bis sieben Jahre. Misteln sind zweihäusig, d.h., es gibt männliche und weibliche Pflanzen. Die sehr kleinen, unauffälligen Blüten erscheinen zwischen Januar und Ende April; die Bestäubung erfolgt über Insekten. An den weiblichen Pflanzen entwickeln sich im Herbst weissliche, fleischige, klebrige Beeren. Sie enthalten meist einen Embryo, aus dem die nächste Mistelpflanze auskeimt.
Um aus dem gallertartigen Fruchtfleisch «befreit» zu werden, sind die Keime ausschliesslich auf die Hilfe von Vögeln angewiesen, speziell Misteldrosseln und Mönchsgrasmücken. Drosseln fressen die reifen Beeren und scheiden die grünen Mistelembryonen über den Kot unverdaut wieder aus. Die Mönchsgrasmücke geniesst nur die saftig-süsse Beerenhülle; den Embryo mitsamt seines schleimigen Fruchtfleisches klebt sie dabei auf Zweige und Äste des mütterlichen Wirtsbaumes. Nach vielen Jahren entwickeln sich mit zunehmender Verzweigung kugelige Büsche von bis zu einem Meter Durchmesser oder auch herabhängende Formen. Misteln können zwischen 60 und 70 Jahre alt werden.
Der botanische Gattungsname Viscum ist identisch mit dem lateinischen Wort viscum für ‚Leim‘. Die Römer stellten aus den klebrigen Beeren Vogelleim her.
Bei der in Mitteleuropa, auch in der Schweiz und Deutschland, weit verbreiteten Mistelart (Viscum album) unterscheidet man nach den Wirtspflanzen drei Unterarten:
- die Laubholzmistel (Viscum album subsp. album),
- die seltene Tannenmistel (V. album subsp. abietis), die ausschliesslich Weisstannen besiedelt,
- die Kiefernmistel (V. album subsp. austriacum), die meist auf Wald-, Schwarz- und Bergkiefern vorkommt.
Die am häufigsten vorkommenden Laubholzmisteln leben auf zahlreichen Laubbäumen, vornehmlich auf Linde, Weide, Pappel, Ahorn, Robinie, Birke, Haselnuss und leider auch Apfelbäumen. Auf der anderen Seite gibt es rätselhafterweise auch «mistelfestere» Bäume wie Eiche, Buche, Esche, Ulme, Platane und einheimische Obstbäume wie Kirsche, Pflaume, Zwetschge und Birne.
Ältere Dokumente stellten fest, dass die Beeren stark, die übrigen Pflanzenteile schwach giftig seien. Andere wiederum behaupteten, der höchste Gehalt an Giftstoffen finde sich in den Stängeln und Blättern, vor allem im Winter. Mittlerweile sind Experten und Giftzentralen überzeugt, die Mistel sei nur schwach giftig, selbst beim Verzehr seien Erste-Hilfe-Massnahmen im Allgemeinen nicht nötig. Vorsichtshalber sollte viel getrunken werden; bei kleineren Kindern könne es zu Magen- und Darmbeschwerden kommen. Im Zweifelsfall und bei anhaltenden Beschwerden sollte eine Ärztin aufgesucht werden.
Umweltämter, landwirtschaftliche Institutionen und der Naturschutzbund (NABU) beklagen, dass der Mistelbefall in einigen Regionen Deutschlands, der Schweiz und Liechtensteins seit Jahren steigt. Apfelbäume gehören zu den beliebtesten Gastgebern der Halbparasiten. Eine Gefahr sind Laubholzmisteln vor allem für Hochstamm-Apfelbäume und Streuobstwiesen, die ja ökologisch wertvolle und artenreiche Lebensräume für Tausende Tier- und Pflanzenarten sind. Je zahlreicher, älter und grösser Misteln werden, desto mehr Wasser und Nährstoffe entziehen sie den Wirtsbäumen und -sträuchern und sorgen letztlich für ihr Absterben.
Wer Misteln nicht als Arznei braucht, kann sich die Hoffnung auf ein wenig «Glück unterm Mistelzweig» ergattern. Die Faszination der Büschel, die hoch über der Erde wachsen, immergrün sind und im tiefsten Winter weiss leuchtende Früchte tragen, hat sich über all die Jahrhunderte gehalten. In Vorzeiten galt die Mistel als heilig; später als Zauberzeichen und romantisches Symbol. Der Brauch des Küssens unterm Mistelzweig und daraus resultierender ewiger Liebe soll ursprünglich aus England kommen. In Deutschland war das Glück nur vielversprechend, wenn die Misteln als Geschenk von Dritten übergeben worden waren. In der Schweiz sind sie ein Fruchtbarkeitssymbol, und in Frankreich hängt man an Neujahr Mistelzweige über die Tür und küsst darunter Freunde und Familie: «au gui l’an neuf» («Mit der Mistel kommt das neue Jahr»). Dass Mistelzweige unter dem Hauseingang platziert wurden, hat ganz praktische Gründe: Die Wärme in Innenräumen würde den Mistel-zweigen nicht bekommen. Im Freien behalten sie ihre Frische und die grüne Farbe wesentlich länger.
