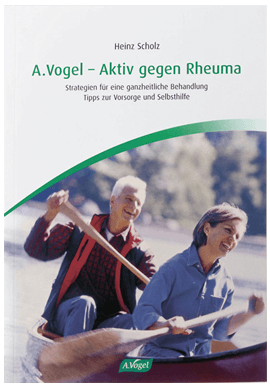A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.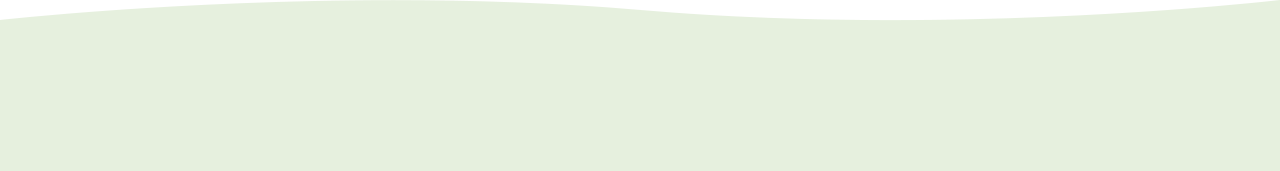
Akzeptanz-Therapie – Hilfe gegen Schmerzen
Warum annehmen statt resignieren richtig sein kann
Nicht immer ist es möglich, Schmerzerkrankungen zu heilen. Dennoch können Betroffene ihre Lebensqualität verbessern. Hilfreich kann dabei die Akzeptanz-und Commitment-Therapie sein.
Autorin: Anja Rech
Ständig wiederkehrende Schmerzattacken, dunkle Phasen bei psychischen Erkrankungen – wer von einer chronischen Krankheit betroffen ist, leidet immer wieder darunter. Doch das muss nicht bedeuten, dass dieses Leiden das ganze Leben überschattet. «Es ist möglich, seine Krankheit anzunehmen, sich nicht von negativen Gefühlen beherrschen zu lassen und so damit umzugehen, dass man trotzdem Lebensqualität gewinnt», erklärt Dr. med. Jörg Manzick, Chefarzt Psychosomatik in der Berolina-Klinik in Löhne bei -Bielefeld. Eine wertvolle Strategie, die er mit seinen Patienten dazu nutzt, ist die Akzeptanz-Commitment-Therapie, kurz ACT.
«Dabei liegt der Fokus nicht so sehr darauf, wie sich die Störungen beseitigen lassen, sondern wie man damit ohne Beeinträchtigungen leben kann», erklärt er. PD Dr. Judith Alder, psychologische Psychotherapeutin aus Basel und Autorin eines Fachbuches über ACT in der Psychoonkologie, ergänzt: «Mit der Therapie lassen sich Reaktions- und Verarbeitungsprozesse so gestalten, dass die Lebensqualität und ein wertorientiertes Leben gefördert werden.» Weil diese Methode den Menschen dazu befähigt zu handeln, spricht man die Abkürzung ACT wie das Verb «act», Englisch für «agieren», aus.
Der Autor Russ Harris erklärt den Namen so: Die Methode lehre uns, die Wirkung und den Einfluss schmerzhafter Gedanken und Gefühle zu reduzieren (Akzeptanz), während wir zugleich handeln, um ein Leben aufzubauen, das reich, erfüllt und sinnvoll ist (Commitment; englisch für: «engagiert handeln»). «Akzeptanz kann man nicht ein- und ausschalten», betont Arne Sörensen, leitender Psychologe der Berolina-Klinik. «Es ist ein Prozess, mit dem sich die inneren Widerstände schrittweise überwinden lassen. Das geht mal besser, mal schlechter.»
«Die ACT ist eine Therapiemethode, die bei allen psychischen und psychosomatischen Erkrankungen anwendbar ist», sagt Dr. Manzick. «Sie ist besonders bei Erkrankungen hilfreich, die durch Schmerzen bestimmt sind.» Das Verfahren kommt aus der Verhaltenstherapie und wird von Verhaltenstherapeuten als Einzel- oder Gruppenbehandlung durchgeführt. Es kombiniert verhaltenstherapeutische Übungen mit Methoden aus dem Achtsamkeitstraining und Akzeptanzstrategien, die zum Teil aus fernöstlichen Philosophien bzw. Glaubensrichtungen wie z.B. dem Buddhismus stammen.
Grundgedanke ist, dass Änderungen des Verhaltens dazu beitragen, dass Betroffene mit ihrer chronischen Krankheit besser zurechtkommen. «Nur logisches Analysieren, rationale Erklärungen reichen nicht aus, um das Verhalten zu ändern», sagt Dr. Manzick. «Wir müssen auch auf die Gefühle und Gedanken schauen: Welche Gedanken beeinflussen die Gefühle und umgekehrt?» Damit könne man an einigen zentralen Problemen der Patienten arbeiten. So nennt er Gedanken, die von etwas ausgehen, das nicht der Realität entspricht, beispielsweise: «Das schaffe ich nicht.» Häufig seien es auch einengende Gedanken und Bewertungen, die Menschen daran hindern, ihren Blickwinkel zu erweitern und neue Ideen zuzulassen.
Die ACT basiert auf sechs «Kernkompetenzen», die Betroffene im Laufe der Therapie erwerben oder verbessern:

Akzeptanz. «Unter Akzeptanz versteht man die Bereitschaft, unangenehme und schmerzliche Erlebnisse zu integrieren und den permanenten Kampf dagegen aufzugeben», erklärt Dr. Manzick. «Durch das Dagegen-Ankämpfen verlieren wir wichtige Dinge des Lebens aus den Augen. Stattdessen ist es hilfreich, sich den eigenen Gefühlen, Gedanken und Impulsen zu öffnen und diese anzunehmen.» Unterstützend wirken dabei bildhafte Vorstellungen, etwa seine schmerzhaften Gefühle in der Hand zu halten wie eine zarte Blume, sie zu umarmen wie ein weinendes Kind oder die Waffen niederzulegen wie ein erschöpfter Soldat.
Kognitive Defusion. Dieser Fachbegriff bedeutet, dass man die Fertigkeit steigert, sich nicht zu sehr in ungute Gedanken oder innere Überzeugungen zu verstricken. «Nehmen Sie Ihre eigenen Gedanken nicht immer für bare Münze», rät er. «Diese müssen nicht automatisch eine Handlung nach sich ziehen.» Als Beispiel nennt er den Satz ‹Ein Indianer kennt keinen Schmerz›. «Wie viele Indianer kennen Sie? Stellen Sie sich vor, Sie würden einen treffen und ihn fragen: ‹Kennen Sie Schmerzen?› Was würde er wohl antworten? Sind Sie sicher, dass er selbst von dem Satz überzeugt wäre?» Solche Überlegungen helfen, die Aussage zu hinterfragen, gedanklich zu bearbeiten und Abstand davon zu halten. «Vielleicht stellen Sie dann fest, dass es sich dabei nur um einen blöden Spruch handelt, der eigentlich keine Relevanz für Sie hat.» Ergänzend zeigt er auf, wie diese Strategie bei einem Gedanken wie ‹Ich bin ein Versager› hilft: «Stellen Sie sich vor, der Satz sei ein Schmetterling, der auf Ihrer Hand gelandet ist. Malen Sie sich aus, Sie würden ihn ganz behutsam von Ihrer Hand wegpusten und er würde davonschweben.»

Achtsamkeit. Diese Methode könnte man auch mit «Gegenwärtigkeit» übersetzen. Es geht darum, im Hier und Jetzt zu sein, statt in die Vergangenheit und die Zukunft abzutauchen. «Der jetzige Moment ist der einzige, den wir aktiv gestalten können», begründet Dr. Manzick. Achtsamkeit beinhaltet eine Haltung gegenüber der Welt und sich selbst, die nicht bewertet. «Ich bin, wie ich bin, auch mal tollpatschig. Aber das ist in Ordnung», wäre etwa ein Gedanke. Typisch für ein Achtsamkeitstraining sind Atemübungen, wie man sie bei einfachen Entspannungsübungen lernt. Sie lassen sich ganz einfach in den Alltag integrieren und zwischendurch nutzen. Der Arzt beschreibt: «Achten Sie darauf, wie die Luft an Ihren Nasenflügeln vorbeistreicht. Gibt es einen Temperaturunterschied zwischen der ein- und der ausgeatmeten Luft? Spüren Sie, wie sie im Körper ein- und ausströmt, wie sich die Schultern leicht heben und senken, wie sich der Brustkorb dehnt und zusammenzieht, die Bauchdecke hebt und senkt. Wie fühlt sich das an?»
Selbst als Kontext oder das wahrnehmende, beobachtende Selbst. Hier konzentriert man sich auf den Teil von sich, der wahrnimmt, beobachtet, und nicht den, der denkt. Im Alltag wertet man oft, hat auch über sich selbst eine innere Wertung. Hier gehe es jedoch darum, sich gleichmütig zu beobachten, nicht wertend. «Mit dieser Fähigkeit üben wir, uns selbst mit unseren eigenen Augen zu sehen und nicht das gedanklich konstruierte Bild, das wir von uns haben – ein Bild, das durch Erwartungen anderer geformt oder stark beeinflusst wird», beschreibt Dr. Manzick.
Werte. Wie wollen wir leben? Welche Rollen wollen wir ausfüllen? Welches sind meine Vorstellungen von einem guten Leben? Mit solchen Fragen kann man sich über die eigenen Werte bewusst werden. «Sie unterscheiden sich häufig von den Werten, die sich aus den Erwartungen anderer speisen», ergänzt der Mediziner. Hilfreich ist dabei etwa der Gedanke, was man seinem Kind vorleben will.
Commitment. «Der Begriff bezeichnet das Engagement, den Willen und die Fähigkeit, das, was ich mir als Werte überlegt habe, umzusetzen», führt Dr. Manzick aus. «Wie übersetze ich es in mein Handeln, wie integriere ich es in mein tägliches Leben?» So könne man den Schmerz in sich hineinnehmen, in sein Selbst integrieren und sogar daran wachsen, statt ihn zu bekämpfen. «Ein Commitment einzugehen, heisst, eine Wahl zu treffen, Schritte in eine bestimmte Richtung zu gehen, und den Kurs zu korrigieren, wenn man davon abge-wichen ist», ergänzt er. Damit können Therapeuten mit ihren Patienten einen anderen Umgang mit ihren Beschwerden erarbeiten.
Die erlernten Techniken der ACT fliessen in den Alltag ein. «Nehmen Sie sich 15 bis 20 Minuten am Tag Zeit für die Übungen», rät Dr. Manzick. «Wichtig ist, dass im Rahmen der Therapie immer wieder überprüft wird, ob das, was man erarbeitet, erkannt und verändert hat, zu mehr Lebensqualität im Alltag führt», betont Dr. Alder.
Die Schweizer ACT-Therapeuten sind der Deutschsprachigen Gesellschaft für kontextuelle Verhaltenswissenschaften angeschlossen. Unter dgkv.info ist eine Therapeutenliste aufgeführt. Bei einer klinisch relevanten psychischen Erkrankung schreibt der Hausarzt eine Verordnung; die Krankenkasse übernimmt die Therapiekosten bei einem eidgenössisch anerkannten Psychotherapeuten. In Deutschland zählt die ACT zu den Verfahren der Verhaltenstherapie, die von den Krankenkassen zugelassen sind und bezahlt werden.
Angeboten werden sie von Verhaltenstherapeuten mit Kassenzulassung und Zusatzausbildung in ACT. Die Therapie umfasst meist 15 Sitzungen.