A.Vogel recherche
Lorsque la recherche interne est activée, des données personnelles telles que votre adresse IP sont transmises à notre moteur de recherche Cludo. Les données sont ainsi transférées vers un pays tiers. Veuillez cliquer ici si vous souhaitez afficher la recherche interne. Vous trouverez plus d'informations sur la protection des données ici : Protection des données.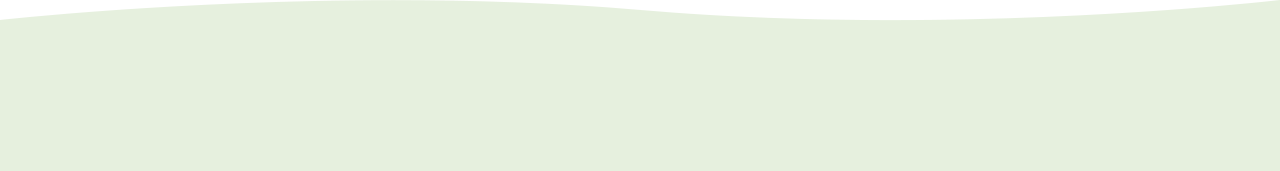
Klimawandel und Heilpflanzen
Der Klimawandel bedroht zunehmend die Heilpflanzen. Was Experten raten.
Weltweit ist die medizinische Biodiversität durch den Klimawandel bedroht. Heilpflanzen müssen besser geschützt und erforscht werden.
Text: Andrea Pauli
Die Hälfte aller weltweit zugelassenen Medikamente der letzten vier Jahrzehnte basierte auf Pflanzenwirkstoffen oder war von ihnen inspiriert. Heilpflanzen, darin stimmen international führende Wissenschaftler überein, sind unverzichtbar zur nachhaltigen medizinischen Versorgung der Menschheit. Erst recht in Regionen der Welt, wo die Bevölkerung kaum Zugang zu kommerziellen Arzneimitteln hat. Doch die Heilpflanzen geraten zunehmend in Bedrängnis: Der Klimawandel setzt ihnen zu, ihre natürlichen Habitate schrumpfen in erschreckender Weise und unkontrollierte Wildsammlungen lassen einige Arten bereits kurz vor dem Aussterben stehen. Zudem geht traditionelles Heilpflanzenwissen durch das Zurückdrängen indigener Kulturen verloren.
Denn das Wissen über Heilpflanzen wird in vielen indigenen Sprachen nur mündlich weitergegeben. Eine Studie der Universität Zürich schätzt, dass weltweit 75 Prozent der Anwendungen jeweils in nur einer Sprache bekannt sind. Besonders heikel scheint die Lage in Nordamerika und im Amazonasgebiet zu sein, wo gar über 86 Prozent des medizinischen Wissens jeweils nur in einer bedrohten indigenen Sprache vermittelt wird. Dabei sollen laut Schätzungen bis zum Ende des Jahrhunderts gut ein Drittel der existierenden Sprachen verschwunden sein und damit wertvolles Heilpflanzenwissen. Immerhin sind laut der Studie weniger als 5 Prozent der untersuchten Heilpflanzenarten selbst unmittelbar gefährdet.

Die Arzneipflanzen für die Herstellung der A.Vogel Naturheilmittel stammen ausschliesslich aus kontrolliert biologischem Eigenanbau, bewilligten Wildsammlungen und nachhaltigen Projekten im Heimatland der Pflanze – unter Berücksichtigung der Bedürfnisse von Land und einheimischer Bevölkerung.
Biodiversitätsforscher haben im Fachmagazin «The Lancet Planetary Health» dazu aufgerufen, die Erforschung von Heilpflanzen systematisch voranzutreiben, um ihr Potenzial für die globale Gesundheitsversorgung nachhaltig nutzen zu können. Klar ist: Das eilt, denn die Gefahr, dass Pflanzen aussterben, noch ehe man ihre Eignung als Heilmittelproduzentin erkannt und erforscht hat, ist immens. Sorgen bereitet den Wissenschaftlern zudem die Tatsache, dass der vom Klimawandel verursachte Stress die Heilpflanzen in ihrer bisher bekannten therapeutischen Wirkung beeinträchtigen könnte. Die pflanzlichen Rohstoffe wären folglich nicht mehr von der benötigten Qualität und Sicherheit.
Mal ganz abgesehen vom Nutzen, den wir Menschen aus den Heilpflanzen ziehen, sind sie immens wichtig für die Natur selbst. «Die bioaktiven Pflanzenstoffe, die wir als Heilmittel einsetzen, erfüllen in der Natur spezifische Aufgaben in der Interaktion von Pflanze und Ökosystem – von der Bestäubung bis zur Bodenqualität», betont Junior-Prof. David Nogués Bravo vom Center for Macrooecology, Evolution and Climate der Universität Kopenhagen. Er ist ebenfalls Autor des vorab genannten Appells. Sekundäre Pflanzenstoffe, die eine starke medizinische Wirkung besitzen können, sind in ökologischen Netzwerken taktangebende Stoffe. Beispielsweise regulieren sie die Bestäubung, wehren Fressfeinde ab, verhindern Infektionen in beschädigten Pflanzenorganen oder regeln Stress wie Kälte und Trockenheit. «Extreme Temperaturen, Dürreperioden und eine erhöhte CO2-Konzentration in der Atmosphäre können dieses komplexe Zusammenspiel stören. Hier müssen die Klima- und Biodiversitätsforschung zusammenarbeiten – auf allen Ebenen, von der genetischen und molekularen bis zu Artengemeinschaften und Ökosystemen –, um Grundlagen für geeignete Schutzkonzepte zu schaffen», fordert darum Nogués. «Heilpflanzen produzieren Medikamente nur, wenn die ökologischen Bedingungen stimmen, daher müssen wir die ökologischen Bedingungen schützen, um natürliche Arzneimittel herzustellen», gibt sein Kollege Dr. Spyros Theodoridis vom Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum Frankfurt zu bedenken.

Hortus-Garten von Markus Gastl. Schlüssellochbeet; die Gitterbox darin enthält Kompost. Im Hintergrund: Obstbaumschnitt, aufgeschichtet als Unterschlupf für Tiere.
Heilpflanzen wirksam schützen, ist also die Herausforderung der Zukunft, zu unser aller Nutzen. Strenge Vorgaben seitens all jener Firmen, die Heilpflanzen importieren, sind unabdingbar. «Die pharmazeutischen Unternehmen sollten nur Material akzeptieren, das ordnungsgemäss zertifiziert und bekannter Herkunft ist, und kein Material, das illegal in freier Wildbahn gesammelt wurde», betont Dr. Theodoridis. Sehr begrüssenswert sind Permakultur-Systeme, die natürliche Ökosysteme nachahmen. Auf diese Weise lassen sich Heilpflanzen nachhaltig anbauen, und man muss sie nicht der Wildnis entnehmen. Wildsammler könnten in solchen Anbausystemen ihr Auskommen finden.
Erfreulich weit ist man bereits, was die Möglichkeiten zur pharmakologischen Untersuchung von Heilpflanzen angeht. Zum einen durch neue Entwicklungen in der Erforschung von Stoffwechselprodukten (Metabolomik). Zum anderen auf genomischer Ebene: Komplexe Wirkstoffmischungen aus Pflanzenextrakten können sehr exakt aufgeschlüsselt und einzelne Komponenten isoliert werden. Beispiel: Die Sequenzierung des Genoms der Eibe, um die für die Biosynthese von Paclitaxel (Zytostatikum, das zur Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt wird) verantwortlichen Gene zu identifizieren.
