A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.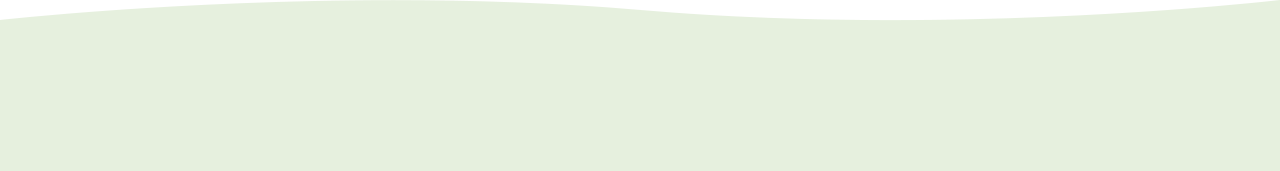
Heilsame Natur: Wandern
Warum es so gut tut, sich draussen zu bewegen.
Wie man in der Natur richtig zur Ruhe kommt, und warum es so gut tut, sich draussen zu bewegen.
Text: Heinz Staffelbach
Wer unter Stress steht, den zieht es früher oder später raus in die Natur. Nach einem langen Spaziergang durch den Wald oder nach einer Wanderung in den Bergen sind wir wieder frisch und lebendig, die Sorgen sind verblasst, und wir sehen den Weg vor uns mit neuer Energie. Es ist, als wäre das Grün durch den ganzen Körper geströmt und hätte uns leichter, weicher und lächelnder gemacht.
Stimmt das? Lassen sich diese Effekte zweifelsfrei messen? Was geht da vor in unserem Körper und in unserer Psyche? Und warum eigentlich bewirken ein Spaziergang oder eine Wanderung in der Natur all diese guten Dinge? Seit einigen Jahren sind Medizin und Wissenschaft diesen heilenden Wirkungen des Wanderns auf der Spur. Die Disziplinen haben verschiedene Namen: Ökotherapie, Ökomedizin oder im englischen Raum ganz praktisch formuliert «green exercises», also «grüne Übungen».
Mit der sitzenden Lebensweise bei einer Mehrheit unserer Jobs ist Bewegungsmangel heute eines der gesundheitlichen Hauptprobleme. Während der frühzeitliche Mensch noch 30 bis 40 Kilometer pro Tag unterwegs war, sind es heute gerade mal ein bis zwei Kilometer. Die Folgen: Übergewicht, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Umgekehrt weiss man, dass Bewegung all diesen Problemen vorbeugen kann. Aber sie kann noch viel mehr, als vor Fettleibigkeit und Herzinfarkt zu schützen. Aerobe Ausdauerbewegung, bei der man auf Touren, aber nicht übermässig ausser Atem kommt, wirkt positiv auf den Hippocampus, eine Hirnregion, bei der Störungen zu Vergesslichkeit und Demenz führen können. Bewegung regt im Hippocampus die Neurogenese an, also die Bildung neuer Nervenzellen.
Erstaunlich: Diese Neurogenese funktioniert auch noch im hohen Alter und sogar bei Alzheimer-Patienten. Die Liste der guten Wirkungen des Bewegens wie Spazieren oder Wandern könnte man noch lange weiterführen. Studien der University of Illinois und der Dundee University haben gezeigt, dass sportliche Kinder besser in Naturwissenschaften und Mathematik sind. Besonders spannend: Kinder lernen Vokabeln besser, wenn sie dabei auf einem Hometrainer pedalen, als wenn sie am Tisch sitzen.

Wandern, Weite, Luft, Natur und gleichgesinnte Gesellschaft: Das stimmt uns glücklich! (Foto: 123RF/peopleimages)
Wie fühlen Sie sich jeweils nach einer Wanderung durch bunte Frühlingswiesen oder zu einem funkelnden Bergsee? Leichter, fröhlicher, gelassener? Es gibt inzwischen viele Studien, die gezeigt haben, dass sich Bewegung wohltuend auf die Psyche und die Stimmung auswirkt. Eine der grössten Untersuchungen mit 1,2 Millionen Probanden hat der Psychiater Adam Chekroud von der Yale University durchgeführt. Sein Befund: Sportlich aktiven Menschen geht es psychisch wesentlich besser. Bewegung mobilisiert die Ausschüttung anregender und stimmungsaufhellender Botenstoffe. Muskeln schütten eine Vielzahl von Myokinen aus: Schätzungen gehen bis zu mehreren Hundert Stoffen, und diese Myokine helfen gegen Diabetes, Rheuma, Herzschwäche und Demenz.
Und schlussendlich hilft Bewegung auch bei Depression. Gemäss einer Studie des Massachusetts General Hospital mit 8000 Personen bringen mehrere Stunden Sport pro Woche signifikant seltenere Depressionen. Auch bei uns in Europa wurden Studien durchgeführt, und eine Reihe davon stammt vom Institut für Ökomedizin an der Paracelsus Medizinischen Universität in Salzburg. Wissenschaftler schickten Probanden zum Wandern in die Berge, während Kontrollgruppen nur Sightseeing unternahmen, oder gar nichts taten. Die Resultate waren verblüffend. Die Bergwanderer hatten durchwegs bessere Werte bei der kardiorespiratorischen Fitness, beim Gleichgewicht, bei der Konzentrationsfähigkeit und sogar bei Parametern des Immunsystems wie der Zahl der Helferzellen und der zytotoxischen Zellen. Sogar Probleme lassen sich besser beim Laufen lösen.
Doch erhalte ich nicht die gleichen Effekte, wenn ich ins nahe gelegene Fitnessstudio gehe und mich auf dem Laufband abmühe? Gute Frage – und auch dazu gibt es inzwischen eine Reihe von Studien, vor allem aus dem «green-exercises»-Forschungsfeld. Da verglich man etwa Personengruppen, die in der Natur wandern gingen oder drinnen auf dem Laufband trainierten. Das Resultat: Beide Gruppen profitierten, die wandernde Gruppe aber mehr. Energielosigkeit und Angst etwa verschwanden bei den Bergwanderern deutlicher als bei den Laufband-Joggern. Überraschend war dies: Joggen in der Natur senkt den Blutdruck, Joggen in der Stadt vermag dies nicht. Kurz: Bewegung ist gut, aber wenn wir dies draussen machen, potenzieren sich die guten Effekte auf die Gesundheit.
ANZEIGE
Vielleicht die spannendste Frage ist, warum denn die Bewegung, das Wandern, so gesund ist für unseren Körper und unsere Psyche. Hier wird es schwieriger mit Messen und Quantifizieren. Aber es gibt ein paar spannende Theorien dazu. Eine erste könnte man unter dem Stichwort Biophilie vereinen, wie sie von Erich Fromm und parallel von E.O. Wilson entwickelt wurde. Biophilie bedeutet Liebe zum Lebendigen. Wir haben eine angeborene Neigung zum Lebendigen. Vielleicht ist dies einfach so, weil unsere Vorfahren in den trockenen Savannen Afrikas Hunderttausende von Jahren auf der Suche nach Grün und Wasser waren. Denn das versprach Leben – und damit Nahrung und Überleben. In uns steckt eine tiefe Sehnsucht nach Natur. Und sind wir zu lange in der Stadt, mit ihrem Lärm und ihrer Hektik und ihrer visuellen Überflutung, dann zieht das eine ganze Reihe von Krankheiten nach sich. Umgekehrt: Das Rausgehen in die grüne Natur, das Wandern oder Spazieren lässt tief in uns ein Gefühl aufkommen, an einem guten, wohlwollenden, nährenden Ort zu sein.
Das könnte auch die Erklärung dafür sein, warum Menschen, die vor ihrem Spitalfenster Grün haben, schneller genesen als Menschen, die dort eine Hauswand sehen. Oder warum Gartenarbeit so wohltuend und heilsam ist.

Nach einer fordernden Wandertour eine entspannte Pause einlegen und bewusst die Natur geniessen: So kommt unsere gestresste Seele zur Ruhe. (Foto: 123RF/lzflzf)
Zwei weitere Theorien, warum Bewegung in der Natur so heilsam wirkt, gehen in eine ähnliche Richtung. Die Stress Reduction Theory (SRT), die auf Professor Roger Ulrich zurückgeht, besagt, dass der Mensch in der Stadt kleineren oder grösseren Stressoren ausgesetzt ist, was das Nervensystem in ständige Alarmbereitschaft versetzt. In der Natur aber fallen diese Stadt-Stressoren weg, der Mensch hält sich in einer Umgebung auf, die positive, wohltuende und entspannende Signale bringt: Grün, Wasser, Leben, Nahrung und Ruhe. Der Spiegel von Stresshormonen geht zurück, das Nervensystem kann sich entspannen.
Die Attention Restoration Theory (ART) von Rachel und Stephen Kaplan wiederum befasste sich bereits in den 1970er-Jahren in den USA mit der Wirkung der Natur. Die Forscher kamen zum Schluss, dass der Mensch in der Stadt und bei einem Bürojob eine Art von Konzentration aufbringen muss, die ermüdet, erschöpft und ins Leere führt (sie nennen dies «effortful attention»). In der Natur hingegen können wir aufmerksam sein, den gurgelnden Bach wahrnehmen, das Rauschen in den Blättern, ohne dass dies ermüdet («effortless attention»).
Wir sind in unserer langen Entwicklungsgeschichte, mit dem unablässigen Streifen durch die Natur, zu den Menschen geworden, die wir heute sind. Ein Leben mit Sitzen, Stress und Bewegungsmangel unter- und überfordert uns gleichzeitig und führt zu Erschöpfung und Krankheiten. Dem können wir zum Glück vorbeugen. Denn wir haben ein wunderbares, kostenloses Heilmittel zur Hand: rausgehen, weg aus der Stadt, spazieren oder wandern, und unsere wunderbare Natur geniessen. Unser Körper, unser Herz und unsere Psyche werden es uns danken, mit Entspannung, neuen Kräften und neuer Heiterkeit.
Stille: Fragen Sie sich vor der Wanderung, was Ihnen heute am besten tut – viel plaudern und sich austauschen, oder lieber mehr Stille und damit mehr Zeit, sich zu spüren und die Natur wahrzunehmen.
Tempo: Welches Tempo ist für die heutige Wanderung am passendsten? So richtig auf Touren kommen und am Abend wohlig müde sein, oder lieber gemächlich und leicht durch die Landschaft schlendern? Achten Sie immer wieder darauf, ob Sie mit diesem Tempo unterwegs sind.
Achtsamkeit: Versuchen Sie immer wieder, ins Wahrnehmen zu kommen. Den Körper wahrnehmen, die Gefühle und die Gedanken, aber auch die Umgebung mit allen Sinnen. Das hilft, im Hier und Jetzt zu bleiben.
Pausen: Pausen sollten nicht nur da sein, um Atem zu holen und ein Hungerloch zu stopfen. Man kann sie richtig zelebrieren. Ein schönes Plätzchen suchen, es sich bequem machen und einfach geniessen. Solche Pausen sind Balsam für unsere Seele.
Dankbarkeit: Wir können für so viel dankbar sein auf einer Wanderung. Dankbar für unseren Körper, für die schöne Natur um uns herum, für das schützende Heim, das auf uns wartet. Dankbarkeit fühlen macht glücklich.




