A.Vogel Suche
Bei Aktivierung der internen Suche werden personenbezogene Daten, wie beispielsweise Ihre IP-Adresse, an unsere Suchmaschine Cludo übertragen. Eine Datenübermittlung erfolgt damit an einen Drittstaat. Bitte klicken Sie hier, wenn die interne Suche angezeigt werden soll. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie hier: Datenschutzerklärung.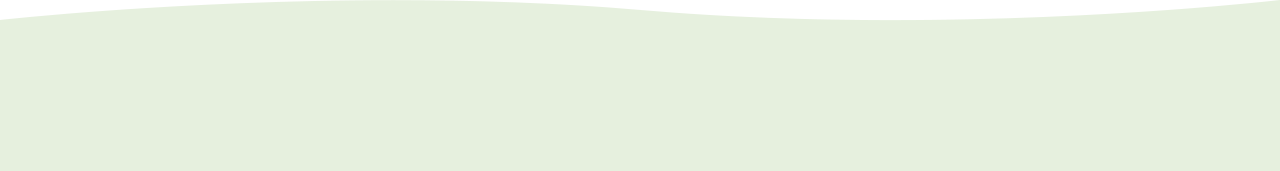
Was bei Muskelkater hilft
Richtiges Muskeltraining ist und hält in jedem Alter gesund
Muskelkaterschmerzen kennt fast jeder. Woher sie kommen, wie man sie wieder los wird und vermeidet.
Text: Ingrid Zehnder
- Fiese Muskelschmerzen
- Definition von Muskelkater
- Symptome des Muskelkaters
- Wer ist gefährdet?
- Wissen über die Bewegungsphasen
- Was bei Muskelkater hilft
- Wärme
- Bewegung
- Arnika
- Schlaf
- Viel trinken
- Kurkurma oder «Goldene Milch»
- Ausgewogen essen
- Was bei Muskelkater nichts nützt
- Muskelkater möglichst vermeiden
- Tipps gegen Seitenstechen
Nicht nur ausgesprochene Sportmuffel und bequeme Couchpotatoes haben ein schlechtes Gefühl, weil sie körperlich nicht aktiv sind – nein, in der Schweiz leidet jede und jeder Vierte unter mangelnder Bewegung. Noch schlechter sieht es in Deutschland aus: Mehr als 40 Prozent der Erwachsenen schaffen es nicht, die von der WHO empfohlenen 150 Minuten pro Woche körperliche Aktivität zu erreichen. Weil allerorten ständig angemahnt wird, sich der Gesundheit zuliebe sportlich zu betätigen, prüft die eine oder der andere einen Wechsel des eigenen Lifestyles. Doch kaum hat man sich aufgerafft, es mit Wandern, Joggen, mit Bauch- und Rückenübungen zu probieren, kommen unverhofft die fiesen Muskelschmerzen, und es ist schnell vorbei mit den guten Vorsätzen und der anfänglichen Euphorie.
Das Wort «Kater» ist eine Verballhornung des Wortes «Katarrh», das die Entzündung von Schleimhäuten, besonders der Atmungsorgane, umschreibt. Eine frühere Theorie zur Entstehung eines Muskelkaters, die sich lange hielt, ist heute widerlegt: Die Schmerzen entstehen nicht aufgrund einer Übersäuerung durch Milchsäure. Die medizinische Forschung zu den Ursachen begann erst in den 1980er-Jahren. Der Mechanismus, der hinter einem Muskelkater steckt, ist ziemlich kompliziert. Ein Muskel besteht aus mehreren Muskelfasern, die wiederum aus Hunderten kleinster Muskelfibrillen bestehen. Eine Muskelfibrille enthält mehrere Sarkomere, das sind winzige zur Kontraktion und Entspannung fähige Bauteile. Die aus Proteinen bestehenden Sarkomere sind die kleinsten, funktionellen Baueinheiten der Muskelfibrillen. Sie werden zu beiden Seiten von sogenannten Z-Scheiben begrenzt. Eine zu grosse Belastung führt dazu, dass dünne Eiweissfäden aus ihrer Verankerung in den Z-Scheiben reissen.
Die dabei entstehenden Risse (Mikrotraumen) betreffen nicht die gesamte Muskelfaser, sondern nur etwa 30 Prozent der Z-Scheiben. Immerhin gerät dadurch der Stoffwechsel durcheinander, und es dringt Wasser ein, was zu einer Schwellung führt, die auf das umgebende Bindegewebe der Muskelfaser drückt. Dabei beginnt der Muskel härter und unbeweglicher zu werden. Die Reaktion des Körpers tritt zeitverzögert ein, was erklärt, warum Muskelkater nicht während des Sports auftritt, sondern erst einige Stunden oder Tage später.
Muskeln, die von ungewohnten Belastungen betroffen sind, führen zu deutlichen Bewegungseinschränkungen, fühlen sich verhärtet oder sogar etwas geschwollen an, sind druckempfindlich und selbst bei kleinsten Bewegungen schmerzhaft. Prinzipiell können alle überbeanspruchten Muskeln Schmerzen bereiten – an Armen, Schultern, Nacken, Rücken und Bauch; besonders häufig sind Oberschenkel und Wadenmuskeln die Leidtragenden. Das Gute: Der menschliche Körper ist – wenn man ihm etwas Zeit lässt – in der Lage, die kleinen Verletzungen selbstständig zu reparieren. Muskelkaterschmerzen sind, wenn auch hinderlich, harmlos und sollten nach einer Woche abgeklungen sein. Was gegen Muskelkrämpfe hilft, erfahren Sie hier.
Das Risiko, einen Muskelkater zu bekommen, besteht vor allem für Menschen, die lange nicht trainiert haben und/oder sich bei neuen, ungewohnten Aktivitäten überfordern. Trainingsanfänger sollten nicht zu viel «Gas» geben, sondern die Übungen (unter fachlicher Beratung) sicher aufbauen. Aber auch erfahrene (Leistungs-)Sportlerinnen und Sportler können unter Muskelkater leiden, wenn sie neue Bewegungsabläufe einüben, andere Muskelgruppen trainieren, eine weitere Sportart erlernen oder das Training intensivieren.
Die Sportmedizin und Fitnessfachkräfte unterscheiden zwischen konzentrischer (überwindender) und exzentrischer (abbremsender) Muskelarbeit. Die meisten (Kraft-)Übungen bedingen sich gegenseitig. So werden bei einem Klimmzug die Armmuskeln beim Hochziehen konzentrisch trainiert; beim langsamen, kontrollierten Herablassen in die Ausgangsposition ist die Bewegung exzentrisch.
In der konzentrischen Phase zieht sich der Muskel zusammen und arbeitet gegen den Widerstand, weil man beispielsweise ein Gewicht anhebt. Dabei wird der Muskel verkürzt. In der exzentrischen Phase wenden die Muskeln Kraft auf, um sich in die Länge zu ziehen, d.h. zu dehnen. Dies geschieht bei abrupten Richtungswechseln wie beispielsweise im Fussball, beim Squash oder Tennis. Auch bei der Landung nach Sprüngen, beim Herabsenken eines Gewichts aus der Beuge in die Streckung, beim Heruntergehen von einem Berg spricht man von exzentrischer Muskelarbeit.
Leistungssportler profitieren von etwas mehr Kraft- und Muskelaufbau beim exzentrischen als beim konzentrischen Training. Für Anfänger hingegen kann exzentrisches Training, etwa mit (zu) grossen Gewichten zu Krämpfen und Zerrungen führen.
Beide Arten von Muskelarbeit beeinflussen das Auftreten von Muskelkater, doch besonders häufig sind die unangenehmen Schmerzen nach exzentrischer Belastung. Dabei sind zwar weniger Muskelfasern aktiv, die allerdings stärker belastet werden. So ist das Risiko für Mikrotraumen erhöht und das Auftreten von Muskelkater begünstigt.

Meist wird bei Muskelkater in den ersten Tagen vor allem Ruhe und Schonung empfohlen. Die betroffenen Muskelgruppen brauchen Erholung, um die Mikroverletzungen reparieren zu können und so letztlich die Muskeln durch den Wiederaufbau des Gewebes zu stärken.
Wärme tut gut. Wissenschaftliche Studien belegen, dass Wärme einen positiven, weil durchblutungsfördernden und krampflösenden Effekt hat.
- Warme Bäder und Wickel
- heisse Duschen oder Saunabesuche
Leichte Bewegung hilft. Möglichst bewegungslos zu bleiben, wenn sich die ersten Symptome bemerkbar machen, ist keine gute Idee. Hingegen macht es Sinn, durch locker-sanfte Bewegungen und leichte Aktivitäten wie Spaziergänge oder unangestrengtes, ruhiges Jogging die Durchblutung zu steigern und dadurch den Heilungsprozess zu fördern.

Zur Schmerzlinderung eignet sich ein Arnikafrischblüten-Gel zum Einreiben, das auch abschwellend und entzündungslindernd wirkt.
Ausgiebige Nachtruhe und, wenn möglich, ein Mittagsschläfchen ist die bestmögliche Regeneration. Tipps für erholsamen Schlaf?
Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr unterstützt die Regeneration, indem sie den Abtransport von Abfallstoffen aus den Zellen fördert. Viel Wasser zu trinken, kann auch bei Schmerzen und Steifheitsgefühlen helfen. Amerikanische Forscher haben in einer Studie nachgewiesen, dass die entzündungshemmenden Antioxidantien in Kirschen und Kirschsaft die Regeneration und Heilung des Muskelgewebes unterstützen und beschleunigen.

Als Geheimtipp gilt auch Kurkuma. Der Inhaltsstoff Curcumin soll helfen, den Muskelkater abzuschwächen und die Erholung der Muskeln zu fördern. Curcumin ist fettlöslich, daher werden dem heissen Kurkumatee ein paar Tropfen Öl zugegeben. Das ayurvedische Getränk «Goldene Milch» gilt traditionell als wärmend, heilend, anregend und reinigend.
Rezept für eine Portion:
- 250 ml Pflanzendrink (z.B. Hafermilch)
- 1–2 cm Kurkuma fein gerieben oder 1 TL Kurkumapulver
- 1–2 cm Ingwer fein gerieben
- 1 TL Zimt
- 1 Prise schwarzer Pfeffer (erhöht die Bioverfügbarkeit des Curcumin)
Alle Zutaten in einen Topf geben, langsam erhitzen (nicht kochen). Durch ein Sieb in die Tasse giessen. 1 Tasse abends trinken.
Eine eiweiss-, mineralstoff- und vitaminreiche Kost mit Nüssen, Mandeln und Hülsenfrüchten, Geflügel und Fisch, Vollkornprodukten, Kirschen, Bananen, Ananas, Kiwis und dunklen Beeren, Hüttenkäse und Eiern kann der Heilung der minimalen Muskelschäden zugutekommen.
Massagen. Muskelschäden im Gewebe können durch Massagen nicht gebessert werden; die Heilung wird eher verzögert. Eine Massage, wie sie sich Profisportler oft gönnen, sollte etwa eine Stunde nach der Belastung (bevor man weiss, ob Mikrotraumen entstanden sind bzw. ein Muskelkater kommen wird) ausgeführt werden; auf diese Weise werden die Muskeln entspannt und mit Energie versorgt. Wird der Muskelkater am nächsten Tag festgestellt, ist eine Massage sinnlos – sie schadet mehr als sie nützt.
Dehnen. So lange der Muskelkater akut ist, sind Dehnreize nicht angebracht, denn sie können die feinen Faserrisse zusätzlich verstärken.
Schmerzmittel. Abraten muss man von entzündungshemmenden Schmerzmedikamenten (z.B. Ibuprofen, Diclofenac); sie haben eine negative Wirkung, da sie die Reparatur des beschädigten Gewebes behindern und die wachsende Anpassung der Muskelzelle an das Training hemmen.
Kälte und Eisbäder. Allenfalls recht kurz nach der Belastung kann Kühlung hilfreich sein, um die Schwellung nicht zu stark werden zu lassen. Ansonsten ist Wärme besser.
Magnesium. Für eine rasche Linderung des Muskelkaters wird der Mineralstoff manchmal empfohlen. Wissenschaftliche Belege für einen Nutzen gibt es keine.
Der Abbau von Muskelmasse beginnt schon ab dem 30. Lebensjahr mit bis zu einem Prozent jährlich. Unternimmt man nichts dagegen, kann man mit 80 Jahren schon 50 Prozent Muskelmasse verlieren. Körperliche Aktivität und trainierte Muskeln sind jedoch Voraussetzung für Gesundheit, Selbstständigkeit und Lebensqualität bis ins hohe Alter. Mit gezieltem Training kann man in jeder Lebensphase beginnen, die Muskeln zu stärken und so dem physiologisch bedingten Muskelschwund entgegenzutreten. Wie auch immer das sportliche Training oder persönliche Work-out aussieht, es sollte den individuellen Bedürfnissen, Möglichkeiten und Fähigkeiten angepasst sein. Sinnvoll ist, mit geringerer Intensität zu starten und diese in kleinen Schritten zu steigern – aber konsequent bei der Stange zu bleiben.
Falls ein Muskelkater dazwischenkommt, denken Sie daran: Er verschwindet innerhalb von ein paar Tagen ganz von selbst, vorausgesetzt, ausreichend Ruhe, Schlaf und gesunde Ernährung unterstützen den Regenerationsvorgang – und das Training kann gestärkt wieder aufgenommen werden. Trotzdem sollte ein Muskelkater nicht zu oft vorkommen. Denn Muskelkater ist kein Zeichen für ein effektives, der individuellen Verfassung angepasstes Training, sondern immer ein Hinweis auf eine Überforderung der betroffenen Muskeln. Das Risiko sinkt, wenn man sich vor der sportlichen Bewegung gesund fühlt und sich gut aufwärmt.
Die schmerzhaften Stiche unterhalb der Rippen hat fast jeder schon mal empfunden. Vor allem bei ungewohnter sportlicher Anstrengung und bei Ausdauersportarten tauchen die Schmerzen auf, mal rechts, mal links oder beidseitig. Wie und warum die Seitenstiche entstehen, ist nicht abschliessend geklärt. Es gibt jedoch einige gute Tipps, wie man deren Entstehung lindern oder vermeiden kann:
- vor dem Sport ausreichend aufwärmen,
- nicht mit vollem Magen laufen oder trainieren,
- möglichst auf Lebensmittel verzichten, die im Darm Gase bilden,
- während des Sports ausreichend trinken,
- auf eine aufrechte Körperhaltung und regelmässige, tiefe Atmung achten.
Wenn doch Schmerzen auftreten:
- das Tempo drosseln oder eine Pause einlegen,
- bewusst einige tiefe Atemzüge machen und
- den Körper mit nach oben gestreckten Armen zu einer Seite dehnen.
ANZEIGE




